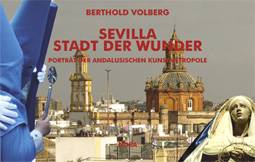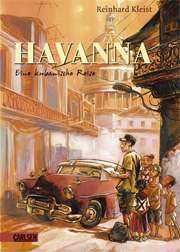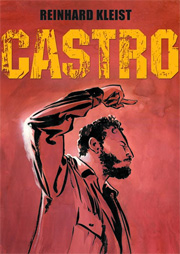ed 08/2011 : caiman.de
kultur- und reisemagazin für lateinamerika, spanien, portugal : [aktuelle ausgabe] / [startseite] / [archiv]
|
spanien: Ronda - der Gipfel der Romantik
BERTHOLD VOLBERG |
[art. 1] | druckversion: [gesamte ausgabe]  |
|
|
brasilien: Von Tsutiura nach Itaquaquecetuba
Das Schiksal der da Silvas nach dem Jishin ANJA KESSLER |
[art. 2] | ||
|
guatemala: Migrationswaisen
KATHARINA NICKOLEIT |
[art. 3] | ||
|
venezuela: Kakao / Karibik / Chuao (Bildergalerie)
DIRK KLAIBER |
[art. 4] | ||
|
amor: Copacabana im Winter
THOMAS MILZ |
[kol. 1] | ||
|
erlesen: Dolce & Habana
Castro und Havanna. Eine kubanische Reise von Reinhard Kleist TORSTEN EßER |
[kol. 2] | ||
|
macht laune: Tapa zum Bier
DAMIAN SCHMIDT |
[kol. 3] | ||
|
lauschrausch: Villa-Lobos in Jazz / En la imaginación
TORSTEN EßER |
[kol. 4] |
| [art_1] Spanien: Ronda - der Gipfel der Romantik "Inmobiliaria Rilke" - von dieser unübersehbaren Reklametafel werde ich, mit dem Bus von Málaga kommend, am Ortseingang der andalusischen Kleinstadt Ronda (35.000 Einwohner) begrüßt. Es ist schon erschütternd, wofür einer der größten deutschen Dichter hier seinen Namen hergeben muss. Und alles nur, weil er hier, wie viele vor und nach ihm, mal ein paar Wochen Urlaub gemacht hat. Rainer Maria Rilke (1875 - 1926) hätte es natürlich nicht Urlaub genannt, sondern "Inspirationssuche", da er von Anfang Dezember 1912 bis Mitte Februar 1913 während einer schöpferischen Krise auf diesem entrückten Felsplateau in der Bergwelt Andalusiens neue Horizonte zu entdecken suchte: mit Erfolg - ein paar seiner schönsten Gedichte entstanden unter den hier gesammelten Eindrücken, nachdem er zur Zeit der Mandelblüte widerwillig Abschied nahm von Ronda. Unbewusst wurde der Ronda-Pilger Rilke zu einem Pionier, dem Scharen von Kulturtouristen folgten - getrieben von der Sehnsucht nach dem "echten Spanien" und der unverfälschten Natur Andalusiens. Und es gibt nicht viele, die nicht fasziniert sind von diesem unwirklichen Ort, der entrückt von der Welt wie ein Adlerhorst über dem Schwindel erregenden Abgrund schwebt. So lasse ich das profane Reklameschild der Immobilienfirma schnell hinter mir, um ungeduldig ins Herz dieser 2600 Jahre alten und auf 780 Metern Höhe gelegenen Stadt vorzustoßen: die Brücke über dem Abgrund. Und obwohl ich wie die meisten Reisenden, die von mythischen Orten angezogen werden, das oft fotografierte Motiv schon auf Bildern gesehen habe, ist es ein ganz besonderer Moment.
Seitdem ist Ronda ein Gesamtkunstwerk aus Naturwunder (dem Schwindel erregenden Cañon) und Architektur (der Überbrückung desselben). Diese Wunderbrücke war und ist multifunktional. Früher befand sich im oberen Brückenbogen ein Kerker: das Gefängnis mit der spektakulärsten Aussicht in ganz Spanien. Davon sahen die Inhaftierten allerdings nichts, sie waren in fensterlosen Zellen eingekerkert, denn das einzige Fenster war der Residenz des Wärters vorbehalten. Heute befindet sich ein kleines Museum in der Brücke. Vor meiner Fahrt nach Ronda hatte mich ein Freund aus Madrid, der dort neben der für Suizid-Pläne so berühmten Puente de Segovia wohnt, scherzhaft gewarnt, die Brücke von Ronda mit dem beinahe Höhenangst verursachenden Blick in den Abgrund sei ein "Traum für jeden Selbstmörder". Ronda jedoch lädt mit seiner Schönheit eher zum Weiterleben ein. Und die Brücke von Aldehuela bringt mit ihrem Panorama nicht nur Maler und Dichter, sondern auch gewöhnliche Besucher zum Schwärmen. Blickt man nach Osten, kann man die engste Stelle der Schlucht betrachten. Bei den Cuenca-Gärten trennen kaum 20 Meter die turmhohen Felswände. Doch nach Westen weitet sich die Aussicht - hinter dem gewaltigen Felsen, auf dem in privilegierter Lage der Parador thront, breitet sich einige Etagen tiefer vor der Mündung der Schlucht das Bergland von Ronda aus. Wie viele, die zum ersten Mal nach Ronda kommen, habe ich sehr lange auf dieser Brücke gestanden und die andalusischen Landschaftsimpressionen auf mich wirken lassen. Am Abend, als das grelle Siesta-Licht rötlichen Farbschattierungen weicht, folge ich dem Rat der freundlichen Dame vom städtischen Tourismus-Büro. Sie hatte mir gleich nach meiner Ankunft empfohlen, mich kurz vor Sonnenuntergang hinter dem arabischen Torbogen zu postieren, der in der Tiefe unterhalb der Brücke steht.
Also steige ich mit der sinkenden Sonne hinab in die Schlucht, einem gewundenen Trampelpfad folgend, bis ich zum "Arco de Cristo" komme. Ein etwas unpassender Name für ein islamisches Stadttor. Es handelt sich um das einzige Überbleibsel der arabischen Stadtmauer auf der Westseite von Ronda, einen schönen Hufeisen-Torbogen, der sich malerisch vor der Mündung der Schlucht erhebt. Die Perspektive von diesem Punkt auf die oben im Himmel auf ihrem Felsenthron schwebende Stadt ist faszinierend und hat schon nüchterne Seelen in hemmungslose Begeisterung gestürzt. Man muss nicht Rilke sein, um Ronda "bezaubernd" zu finden. Hier stand bereits im 11. Jahrhundert Almutamid, der (Dichter)König von Sevilla, und komponierte Verse, nachdem er Ronda seinem Reich einverleibt hatte. Ähnlich zufrieden folgten ihm im Jahr 1485 die Katholischen König nach ihrer Eroberung (allerdings ganz ohne poetische Ambitionen). Beide mussten sich natürlich mit dem Anblick der nackten Schlucht ohne Brücke begnügen.
In einem Punkt hatte die Dame vom Tourismus-Büro zuviel versprochen. Den besten Postkarten-Blick hat man nicht durch den "Arco de Cristo". Denn egal nach welcher Seite man sich verrenkt, der Torbogen versperrt immer die Sicht auf etwa ein Drittel der Brücke. Am besten stellt man sich direkt neben das Tor, um das übliche Postkarten-Motiv der Guadalevín-Schlucht mit Brücke und den beiden urbanen Felsplateaus einzufangen, wenn der Sonnenuntergang die Felsen rötlich schimmern lässt. Man könnte in diesem Abendlicht alles rundum fotografieren, bis die Kamera selbst zu glühen beginnt. Aber ausgerechnet jetzt erklingt ein hektisches Piepsen - der Akku ist leer! In meiner Begeisterung über all die Romantik rings umher hatte ich die blinkende Anzeige wohl übersehen. Wenn überhaupt, habe ich nur noch einen Schuss frei. Ich warte zehn Minuten, bis der Akku genug Energie für ein letztes Foto gesammelt hat und drücke ab, gerade noch rechtzeitig vor dem Verschwinden der Sonne. Kein Licht mehr und Akku leer - dies ist der richtige Moment, um die Besichtigung der Altstadt südlich der Brücke auf morgen zu verschieben.
Es ist ein sonnendurchfluteter Morgen. Ich gehe durch das Stadtviertel "Padre Jesús" und überquere diesmal den Guadalevín im Osten. Die alte arabische Brücke ist ein Winzling verglichen mit den gigantischen Pfeilern der Aldehuela-Brücke. Entlang der vollständig erhaltenen arabischen Stadtmauer (13. Jahrhundert) an der Ostflanke der Altstadt durchschreite ich die Chechauen-Gasse, um an die Südspitze von Ronda zu gelangen. Dort erwartet mich hinter der Puerta de Almocábar auf einem Hügel die wuchtige Renaissance-Kirche Espíritu Santo. Die Taube des Heiligen Geistes über dem Eingangsportal wirkt etwas debil und die Fassaden sind streng und relativ schmucklos. Das Kircheninnere ist deutlich prächtiger mit kunstvollen Gewölben und schönen Skulpturen in den Seitenkapellen. Vor allem ein toter, im Grab liegender Christus ist beeindruckend. An der rechten Seite kann man den Turm besteigen, der kaum höher ist als das Kirchenschiff. Von dort hat man einen guten Ausblick auf die Wachtürme und Zinnen der Stadtmauer - und direkt unterhalb des Turms auf eine Hausruine ohne Dach, die mit einem Trümmerberg gefüllt worden ist. An der einzigen Stelle, an der potenzielle Eroberer Zugang zur Stadt hatten, ohne 100 - 160 Meter hohe, oft senkrechte Felswände erklimmen zu müssen, erhebt sich noch heute das mächtige Mauerwerk der Puerta de Almocábar mit zwei halbrunden Wachtürmen und drei hintereinander gestaffelten Torbögen. Heutzutage pittoreske Eingangspforte, damals (fast) unüberwindliche Festung.
Von Süden gehe ich jetzt durch die Hauptstraße der Altstadt, die Calle Armiñán, zum Rathausplatz. Es ist eher eine Gasse; in dieser romantischen Spielzeugstadt ist eben alles etwas kleiner als anderswo. Nur die Hauptkirche hat ambitionierte Dimensionen. Zwischen dem langen Riegel des Ayuntamiento und einem kleinen Park mit Orangenbäumen und duftenden Blumen ragt der Turm von Santa María la Mayor in den blauen Himmel. Wie so oft bei andalusischen Kirchen ist der Unterbau vom Minarett der ehemaligen Moschee aus dem 13. Jahrhundert übrig geblieben (innen, rechts vom Eingang, befindet sich ein Überbleibsel des muslimischen Allerheiligsten: ein reich verzierter Hufeisenbogen, der den Mihrab umschloss.) Auf das Minarett setzten die Christen nach der Reconquista einen achteckigen Glockenturm mit filigran durchbrochenen Gesimsen. Santa María la Mayor entstand im frühen 16. Jahrhundert als repräsentativer Renaissancebau. Mit kathedralenartigen Ausmaßen und reicher Innenausstattung demonstriert sie, dass auch Ronda vom Amerikahandel profitiert hat. Besonders sehenswert sind im Innenraum eine wunderschöne barocke Inmaculada, der ultrabarocke Hochaltar mit der Szene der Verkündigung und die auf mächtigen Renaissance-Säulen ruhende Kuppel mit originellem Kronleuchter. Doch etwas anderes macht diese Kirche einzigartig: sie hat einen "Balkon"! Er diente wohl als Tribüne für privilegierte Zuschauer, die Calderons religiösen Theaterstücken oder Prozessionen auf dem Platz beiwohnen durften. Aber auch ohne spektakuläre Veranstaltungen ist diese sakrale, dreistöckige Loggia wunderbar geeignet, um die Aussicht auf die Bergwelt hinter den Stadtmauern, das bunte Treiben auf dem Platz oder die prächtige Barockfassade der Kirche Maria Auxiliadora mit krönender Marienstatue gegenüber zu genießen.
Als Schlusspunkt meines Ronda-Besuchs wähle ich als Stierkampfgegner nicht die berühmte Arena, immerhin die älteste der Welt (1785 vollendet), sondern - den Abgrund. Dahin kommt man durch einen Königspalast. An der Casa del Rey Moro ist kaum noch etwas echt maurisch, obwohl dies durch das schöne, vom berühmten Barockmaler Alonso Cano aus Granada entworfenen Azulejo-Bild an der Fassade suggeriert wird. Dieses Kachelbild zeigt einen maurischen König mit Turban. Der Palast wurde größtenteils Ende des 17. Jahrhunderts erbaut, ist nach wie vor in Privatbesitz und extrem renovierungsbedürftig, wie die bröckelnde Fassade auf der Gartenseite verdeutlicht. Er ist daher für Besucher geschlossen. Geöffnet sind aber die schönen Gärten und "La Mina", das Bergwerk mit der Treppe, die zum Grund der Schlucht führt. Vier Euro sind ein stolzer Preis für eine Treppe, die man mühsam hinab und dann wieder bergauf steigen muss. Als ich von einer distinguierten, arrogant lächelnden Dame meine Eintrittskarte für diesen Höllenschlund in Empfang nehme, ahne ich noch nicht, welche Tortur mir bevorsteht.
Hier in Ronda ist es nämlich umgekehrt: zuerst kommt man ins Paradies, wo man sich in Sicherheit wiegt, und danach stürzt man in die Hölle. Nach dem Abreißen der 4-Euro-Eintrittskarte steht man in einem lichtdurchfluteten Paradiesgarten, in dem kleine, mit glänzenden Kacheln verzierte Brunnen wie Diamanten von üppig rankenden Blütenpflanzen eingefasst werden. Romantik überall und schöne Aussichten vor allem auf die südlichen Stadtviertel. Doch dann der Abstieg. Die Treppe ("La Mina") wurde schon von den Mauren im 14. Jahrhundert unterirdisch an der Felswand entlang in einen Bergstollen gebaut (und im 19. Jahrhundert restauriert). Sie führt im Zickzack-Kurs über 200 Stufen hinab zum fast 100 Meter tiefer liegenden Flüsschen Guadalevín. Auf dieser finsteren Höllentreppe mussten damals christliche Sklaven das Wasser aus dem Fluss nach oben zum Palast des Maurenkönigs schleppen. Ich trage zwar keinen zentnerschweren Wasserkrug, sondern nur einen winzigen Rucksack mit Fotokamera, aber beim Stolpern durch diesen unterirdischen Treppentunnel hat jeder Sklave, der hier jemals Wasser hoch geschleppt hat, mein vollstes Mitgefühl.
Die ersten Stufen bergab springe ich noch übermütig, bis ich bemerke, dass an der Beleuchtung immer mehr gespart wurde und die Stufen immer höher und unregelmäßiger werden. Eben noch durch grelles Sonnenlicht geblendet, muss man sich jetzt vorsichtig im Stollen nach unten tasten. Plötzlich werde ich überholt von jungen Rucksack-Touristen, die begeistert etwas von "authentisch mittelalterlicher Beleuchtung" faseln - um im nächsten Moment paarweise ein halbes Dutzend Stufen in die Tiefe zu stürzen! Aus Begeisterung wird fluchender Unmut. Obwohl vorsichtig geworden, rutsche ich ebenfalls aus auf einer glitschigen Stufe und habe dabei Glück, dass meine Kamera heil bleibt. Es wird immer dunkler im Treppenschacht, überall unter mir hallen Schreie von gestürzten Touristen. Man muss mit dem Fuß abtasten, wie lang eine Stufe ist, manchmal liegt die nächste nur ein paar Zentimeter, manchmal einen halben Meter tiefer. Als sich meine Augen an die zunehmende Dunkelheit gewöhnt habe, sehe ich bizarre Szenen. Ganze Touristengruppen stützen sich gegenseitig beim Abstieg und plötzlich purzelt eine Viererkette wie Dominosteine drei Stufen tiefer und erfüllt den ganzen Tunnel mit einem Echo aus Lachen und wütenden Schreien, je nachdem, wie viel Schmerz beim Aufprall im Spiel ist. Als ich endlich das Licht des Ausgangs erkennen kann, stürze ich selbst zum zweiten Mal, wobei ich mir die Jeans überm Knie zerfetze, von den Schmerzen und der Schürfwunde ganz zu schweigen.
Unten angekommen und endlich wieder im Tageslicht, entschädigt der Blick vom Abgrund der engen Schlucht auf die etwa 120 Meter hohen Felswände und die oben schwebende Stadt etwas für diesen Höllenabstieg. Aber nun muss ich, obwohl schon schweißgebadet, diese Teufelstreppe wieder hinauf! Um einen dritten Sturz zu vermeiden, krabbele ich oft auf allen Vieren, das sieht wahrscheinlich furchtbar albern aus, aber in dieser Finsternis bleibt es unbeobachtet. Unterwegs höre ich noch, wie das gleiche Paar, das eben noch alles "schön mittelalterlich" fand, nun anmerkt, dass ein solcher Treppentunnel in Deutschland wegen eklatanter Sicherheitsmängel längst geschlossen worden wäre.
Ich frage mich, wieso noch kein US-Tourist auf die Idee gekommen ist, die Stadt Ronda zu verklagen. "La Mina" ist nicht nur abenteuerlich, sondern echt gefährlich - einmal Beine brechen für 4 Euro. Dieses unterirdische Höllen-Labyrinth ist eine Touristenfalle und wer sie überlebt und oben wieder keuchend in den Paradiesgarten eintritt, hat drei Wünsche frei: Licht, einen Brunnen voller Wasser, um den Durst zu löschen und das Gefühl, wie ein Engel über dem Abgrund zu schweben, in den man vorher gestürzt ist. So muss sich Rilke gefühlt haben, als er im Januar 1913 kurz vor seinem Abschied von Ronda sein Gedicht "An den Engel" schrieb. Text + Fotos: Berthold Volberg Empfehlungen: Rainer Maria Rilke "An den Engel": http://rainer-maria-rilke.de/100040andenengel.html Oficina de Turismo de Ronda Plaza de España 9, 29400 Ronda Tel. ++34-952169311 Email: otronda@andalucia.org Anreise nach Ronda: Mit Bahn oder Bus von Málaga (oder Sevilla), jeweils ca. 2 Stunden Monumente in Ronda: Santa Maria la Mayor: Geöffnet: Mo. - Sa. 10.00 - 20.00, So. 10.00 - 12.30 und 14.00 - 20.00 Eintritt: 4 Euro Brücken-Museum: Geöffnet: Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 und Sa. + So. 10.00 - 15.00 Eintritt: 2 Euro Kirche Espíritu Santo: Geöffnet: Di. - Sa. 10.00 - 14.00 Eintritt: 1 Euro Stierkampfarena: Geöffnet: Mo. - So. 10.00 - 20.00 Eintritt: 6 Euro Casa del Rey Moro: Garten und "La Mina": Geöffnet: jeden Tag 10.00 - 20.00 Uhr Eintritt: 4 Euro Hotel: Ideal für Anreisen mit der Eisenbahn, direkt gegenüber dem Bahnhof, einfach und ordentlich, EZ ab 25 €: Hostal Andalucía Avenida Martínez Astein, 19. /Esquina Avenida de Andalucía frente a Renfe 29.400 RONDA Tel/Fax: 952 87 54 50 Email: info@hostalandalucia.net Restaurant: BODEGA CASA MATEOS c/Jerez,6 29400 - Ronda (Málaga) Telefono 670 67 97 62 Email: bodegacasamateos@hotmail.com http://bodegacasamateos.blogspot.com/ Ein rustikaler Gourmet-Tempel mit guter Weinkarte und innovativen Gerichten, die typisch Andalusisches mit Einflüssen aus aller Welt, besonders aus dem Maghreb, kombinieren. Besonders zu empfehlen sind die gratinierten Artischocken, die Spieße mit gegrilltem Ziegenfleisch, die marinierten Rosada-Fischfilets, der Salat mit Ziegenkäse und zum Dessert Kastanien-Biskuit. Das extrem alternative Gazpacho aus Bombeeren mit getrocknetem Thunfisch-Schinken ist aber wohl nur etwas für Mutige.
[druckversion ed 08/2011] / [druckversion artikel] / [archiv: spanien]
|
| [art_2] Brasilien: Von Tsutiura nach Itaquaquecetuba Das Schicksal der da Silvas nach dem Jishin Es hat wieder angefangen zu nieseln, an diesem kalten Julinachmittag in Itaquaquecetuba und Terumi wickelt ihrer Tochter Laura noch einen zusätzlichen Wollschal um den Hals. Itaquaquecetuba wird von Menschen bewohnt, die das Wachstumsmonster São Paulo füttern. Man erreicht es nach einer Stunde Zugfahrt, vorbei an unverputzten Backsteinhäuschen mit Wellblechdächern, Fabriken und Autowerkstätten.
Die Sechsjährige muss jetzt zum Einschulungsgespräch in die nahegelegene Grundschule, die Direktorin hat persönlich darum gebeten. Laura ist kein gewöhnlicher Fall - das Mädchen hat vorher noch nie eine Schule besucht und kennt die portugiesische Sprache nur aus ihrem Elternhaus. Die Sprache, mit der sie aufgewachsen ist und die sie akzentfrei spricht, ist japanisch. Und in Japan sollte sie dieses Jahr eingeschult werden. Doch seit dem Jishin ist alles anders. Seit vier Monaten leben Laura Alves da Silva, ihre Eltern Terumi und Gonçalo, ihre Geschwister Najilla, Yolanda und Marcelo mit dessen Ehefrau Eloane und Söhnchen Yohan in Brasilien. Das Jishin, das Erdbeben, hat ihrem Leben schlagartig eine andere Richtung gegeben, eine Richtung, die sie sich nicht gewünscht haben. Nach sechzehn Jahren in Japan musste die Familie nach Brasilien zurückkehren. Laura und ihre Schwester Yolanda sind zum ersten Mal in dem Land ihrer Eltern, von dem die Kinder immer sagten, sie würden es ganz gern mal besuchen - aber eben nur besuchen. Najilla war ein Säugling und Bruder Marcelo zehn, als die Eltern vor sechzehn Jahren mit der Hoffnung auf ein besseres Einkommen nach Japan emigrierten. Eigentlich ging es ihnen gut im Jahre 1996, Brasilien erholte sich gerade von der Hyperinflation und Gonçalo verdiente ganz ordentlich als Angestellter bei einem Friseur. Seine Ehefrau Terumi hatte einen sicheren Job als Pharmazeutin. Doch Gonçalos heimlicher Traum war es, Schauspiel zu studieren und jahrelang schmiedete er Pläne, wie wohl solch eine kostspielige Ausbildung zu finanzieren sei. Terumi gelang es einige Zeit, ihm die Flausen aus dem Kopf zu treiben, aber eines Tages hatte er sie soweit - mit ihr als japanischstämmige Brasilianerin würden sie keine Schwierigkeiten haben, ein Arbeitsvisum in Japan zu erhalten und ein paar Jahre lang den brasilianischen Währungsneuling Real gegen harte Yens einzutauschen. Viele Nisseis, japanischstämmige Brasilianer, entschieden sich damals, den klassischen Gastarbeitertraum zu leben - ein paar Jahre ordentlich ranklotzen, um danach zurück in Brasilien etwas Eigenes aufzubauen.
Auch die Familie da Silva kannte ein paar solcher Auswanderer und so wurde, über bereits dort lebende Freunde, die Stadt Tsutiura zum Ziel der Träume von Terumi und Gonçalo - fünfzigtausend Einwohner, zweihundertzehn Kilometer vom Fukushima entfernt. Schon nach ein paar Tagen hatte Terumi einen Job bei Canon, Kopiergeräte montieren. Ihren erlernten Beruf als Pharmazeutin dagegen konnte sie vergessen: "Ich kam mir vor wie eine Analphabetin", erinnert sie sich, "elementares Japanisch und mein brasilianisches Diplom wurden dort nicht anerkannt." Aber egal, man war ja zum Geldverdienen da, zwei Jahre hatten sich die da Silvas gesetzt, das sollte reichen, um genug für die Schauspielausbildung zusammenzusparen. Auch Gonçalo konnte ein paar Tage später bei Canon anfangen, eine Wohnung wurde angemietet und mit Hilfe der brasilianischen Gemeinde fanden sie sich schnell in ihr neues Leben in Tsutiura ein. Ihre Wohnung wurde zu einem Treffpunkt der Brasilienauswanderer und Gonçalo fing bald an, nach Feierabend seinen alten Job auszuüben: Er schnitt den Brasilianern die Haare: "Japaner haben einen ganz anderen Stil, da sind die Brasilianer lieber zu mir gekommen." Die Brasilianer kauften dann auch gerne ihr selbst hergestelltes, typisch brasilianisches Partygebäck, die Salgados, aus der Wohnung wurde ein Haus, aus zwei Kindern wurden vier und aus den zwei Jahren wurden sechzehn. Terumi gab den Job bei Canon auf, Gonçalo verdiente mit Haareschneiden und Fabrik genug, um die Familie zu unterhalten, Terumi kümmerte sich um Kinder und Salgados. JishinAlles lief bestens, bis der 11. März 2011 kam. Der Tag des Jishin, des Erdbebens. - bei diesem Wort frösteln alle, nicht nur wegen des Windes, der in diesem ungewöhnlich kalten südbrasilianischen Winter durch die spärlich eingerichtete Küche pfeift. Die Kinder haben ihre Pullover und Wollstrumpfhosen aus den Koffern geholt. Seit vier Monaten leben sie so, aus Koffern. In der kleinen Wohnung, die ihnen Gonçalos Schwester Lucia überlassen hat, gibt es kaum Möbel und auch keinen Platz dafür. Ein paar Küchengeräte hat Terumi von Bekannten geschenkt bekommen, billiges Plastikzeug. Sie rümpft die Nase: "In Japan hatten wir eine komplette Hi-Tech Küche, mit allem was dazugehört." Wenn Terumi erzählt, fängt fast jeder Satz so an - "In Japan hatten wir…". Und jetzt? "Alles zerstört, uns gehört, was in diese Koffer hier gepasst hat." Es war in den Winterferien, Gonçalo arbeitete noch immer bei Canon, Terumi und die Kinder hatten gerade zu Mittag gegessen, als um viertel vor drei die Erde zum ersten Mal kräftig bebte. An die Uhrzeit können sich alle genau erinnern, weil die Küchenuhr stehen blieb. Terumi hatte inzwischen gelernt, das man bei Erdbeben als erstes die Haustür öffnet, damit diese sich nicht verklemmt und man jederzeit flüchten kann. Sie schickte die Kinder nach draußen, aber im Haus war stark geheizt und bis alle erst mal richtig angezogen waren, flogen vor der Tür bereits die ersten Pkws durch die Luft.
Gonçalo versuchte inzwischen vergeblich, telefonisch seine Familie zu erreichen - "die schlimmsten Stunden meines Lebens". Erst spät in der Nacht schaffte er es nach Hause. Das Haus überstand selbst die stundenlangen Nachbeben, aber die Einrichtung ging nach und nach vor ihren Augen zu Bruch. "Ich wusste nicht mehr, ob es wirklich bebt oder ob mir vor Angst schwindlig war", erinnert sich Terumi. Dann fielen Strom, Gas und Wasser aus. Zeit, das Haus zu verlassen. Doch die Notunterkunft in der nahegelegenen Schule war bereits voll belegt und eine andere nicht in Reichweite. Und so entschied sich die Familie, in ihr Haus zurückzukehren. Nach und nach fand sich eine große Anzahl brasilianischer Freunde ein. "Unser Haus wurde zum Auffanglager", erzählt Gonçalo mit einem Anflug von Stolz. Gemeinsam überstanden sie die Nacht. Am nächsten Tag kam dann die Nachricht - Havarie im Atomkraftwerk Fukushima, 210 Kilometer vom Wohnort der Familie entfernt. Genaueres war nicht zu erfahren, Genaueres hatte man ohnehin nie gewusst. "Die meisten Japaner waren sich nicht einmal klar darüber, wie viele Atomkraftwerke es in diesem Land überhaupt gibt, wir übrigens auch nicht", erzählt Terumi. Doch was sie wussten, war, dass radioaktive Strahlen von irgendwo da draußen auf sie zukamen. Die Angaben über die Größe der verseuchten Gebiete um das Atomkraftwerk änderten sich ständig, vom Wind war die Rede, mal sollte man keine Milch konsumieren, mal kein Leitungswasser trinken, mal bestand keinerlei Grund zur Sorge. Und dann fasste die Familie einen Entschluss: keinen Tag länger als nötig im Land bleiben. Gonçalo nutzte alle ihm zur Verfügung stehenden Kontakte, um über einen brasilianischen Bekannten acht Flugtickets zu erhalten. Und keine 48 Stunden später saß die gesamte Familie im Flugzeug nach Brasilien: Zielort São Paulo, zwei Koffer pro Person. Als Wohnort gaben sie bei der Einreise die Adresse der Schwester in Itaquaquecetuba an. Vielmehr Verwandte haben sie nicht, Gonçalos Eltern leben in einem anderen Bundesstaat, Terumis Vater ist kurz vor dem Erdbeben gestorben, ihre Mutter wohnt in einer bescheidenen Einzimmerwohnung im Stadtzentrum. "Wir müssen Lucia ja dankbar sein, dass wir hier leben dürfen, aber auf Dauer ist das kein Zustand", klagt Terumi und zieht sich eine Wollmütze über die Ohren, "wir müssen uns jetzt erst mal organisieren und ganz von vorne anfangen." "Wir haben nicht nur unser Hab und Gut verloren, wir haben unser Leben verloren", fügt Gonçalo hinzu, "und das müssen wir halt wiederaufbauen."
Sein Sohn Marcelo dagegen hat größere Schwierigkeiten, er hat zwar in Japan eine Ausbildung als Chemiefacharbeiter abgeschlossen, in der Eile des Aufbruchs aber wichtige Dokumente zurückgelassen und kämpft jetzt mit der brasilianischen Bürokratie. Zudem fehlt ihm die praktische Erfahrung. Marcelo würde am liebsten sofort zurück nach Japan, aber auch für das nötige Visum fehlen einige Dokumente, schließlich ist er Brasilianer. Terumi kümmert sich vorerst um die Einschulung der Mädchen, die zwar alle ganz gut portugiesisch sprechen, es aber fast nicht schreiben können. "Ich bin heilfroh, dass wir uns in Japan zuhause immer auf Portugiesisch unterhalten haben, Japanisch wurde nur außerhalb der Familie gesprochen." Jetzt machen sie es genau umgekehrt. Text + Fotos: Anja Kessler [druckversion ed 08/2011] / [druckversion artikel] / [archiv: brasilien] |
| [art_3] Guatemala: Migrationswaisen Manchmal haben Eltern einfach wichtige Dinge zu tun und können sich nicht die ganze Zeit um ihre Kinder kümmern. Vielleicht kennt Ihr das ja auch selber: Papa ist auf Geschäftsreise und Mama muss auch ganz dringend für ein paar Tage weg (oder andersrum), und dann müsst Ihr eine Weile zur Oma oder zu Eurer Tante. Aber das ist dann meistens nur für ein, höchstens zwei Wochen. Doch es gibt auch Kinder, deren Eltern in ein fernes Land gehen müssen, um dort Geld zu verdienen. Dort bleiben sie dann einige Jahre. Und die Kinder, die zu Hause zurück bleiben, vermissen sie ganz schrecklich. Katharina sitzt am Schreibtisch und macht ihre Hausaufgaben. Immer wenn sie aufschaut, blickt sie auf das Foto ihrer Eltern. Katharina hat ihre Eltern schon seit drei langen Jahren nicht mehr gesehen. "Meine Eltern leben in Boston in den USA. Ich verstehe, warum sie da hin gegangen sind. Sie müssen Geld verdienen, damit sie das Schulgeld für mich und meine Geschwister schicken können. Aber ich bin sehr traurig, weil sie nicht bei uns sind." Katharina ist 13 Jahre alt und lebt in Guatemala. Katharinas Eltern sahen keine Möglichkeit genug Geld zu verdienen um ihren Kinder etwas zum Anziehen zu kaufen. Außerdem muss in Guatemala Schulgeld bezahlt werden, und auch das konnten sich die Eltern nicht leisten. Und dann sahen sie im Fernsehen in den amerikanischen Serien immer die tollen Spielsachen, die sie ihren Kindern gerne geschenkt hätten, aber nicht bezahlen konnten. Aus all diesen Gründen gingen Katharinas Eltern in die USA, um dort ihr Geld zu verdienen. "Wir erzählen uns alles am Telefon. Meine Mutter ruft mich fast jeden Tag an. Aber mein Vater arbeitet viel, mit ihm kann ich immer nur am Wochenende sprechen. Und wir schreiben uns Briefe und schicken uns Pakete mit Fotos und Videos", erzählt Katharina. Und so ist die ganze Wand über Katharinas Bett voll mit Fotos ihrer Eltern. Katharina ist aber nicht ganz alleine. Sie hat noch eine 11 Jahre alte Schwester und einen 9 Jahre alten Bruder. Alle drei Geschwister leben zusammen bei den Großeltern, die sich um sie kümmern. In dem Dorf, in dem die drei leben, ist es nichts Ungewöhnliches, dass Eltern ins Ausland gehen und die Kinder zurück lassen. "Es gibt bei uns viele Kinder, die bei ihren Großeltern leben. Aber manchen Kindern geht es dabei nicht gut, denn sie verstehen sich mit ihrer Oma und ihrem Opa nicht. Ich danke Gott dafür, dass er mir gute Großeltern gegeben hat, die sich wirklich um uns kümmern. Trotzdem ist es nicht dasselbe, als wenn unsere Eltern hier wären. Wir fühlen uns oft einsam." Als Katharina das erzählt, muss sie ein bisschen weinen. Ihre Großmutter nimmt sie in den Arm und tröstet sie. Sie hat ihren Enkeln immer wieder erklärt, warum die Eltern nicht zu Besuch kommen können: Wenn sie die USA einmal für eine Reise verlassen, dann können sie nachher nicht einfach wieder einreisen und zu ihrer Arbeit zurückkehren, denn man würde sie nicht über die Grenze lassen. Deshalb wird die Trennung länger dauern. Die Großmutter sagt: "Ich weiß, dass es den Eltern nicht leicht gefallen ist, weg zu gehen. Sie haben das nicht freiwillig gemacht, sondern aus der Not heraus. Sie hätten hier in Guatemala einfach nicht genug verdienen können, um die Familie zu ernähren. Sie schicken uns jeden Monat Geld, mit dem wir die Schule und all die anderen Ausgaben bezahlen können." Seit einem Jahr haben Katharina und ihre Geschwister noch eine kleine Schwester. Sie heißt Carla und wurde in den USA geboren. Die drei haben die Kleine noch nie gesehen. Sie kennen ihre Schwester nur von Fotos und vom Telefon. "Wir rufen sie an und sagen "Hallo Carlita, wie geht es Dir?" und wir singen ihr manchmal Kinderlieder vor. Es ist so schön, sie lachen zu hören und sie kann sogar schon Papa sagen." Katharina wird richtig fröhlich, wenn sie an ihr Schwesterchen Carla denkt. Ob sie nicht ein bisschen eifersüchtig auf sie sei, weil Carla bei ihren Eltern sein könne und sie nicht? "Meine Eltern haben uns ganz oft gesagt, dass wir alle einen besonderen Platz in ihrem Herzen und sie uns alle gleich lieb haben. Und sie haben uns versprochen, dass wir uns eines Tages wieder sehen. Wir hoffen, dass dieser Tag auch wirklich kommt", sagt Katharina. Doch wann das sein wird, dass wissen Katharina und ihre Geschwister nicht. Sie werden zwar auch dieses Jahr zu Weihnachten wieder ein großes Paket mit schönen Spielsachen bekommen, aber ihre Mama und ihr Papa werden nicht dabei sein, wenn sie es auspacken. Dabei wäre ihnen das viel lieber als jedes noch so tolle Geschenk. Aber vielleicht schaffen es Katharinas Eltern ja nächstes Jahr, soviel Geld zu sparen, dass sie nicht mehr in den USA arbeiten müssen und nach Hause zu ihren Kindern zurückkommen können. Text: Katharina Nickoleit Weitere Informationen über die Autorin findet ihr unter: www.katharina-nickoleit.de [druckversion ed 08/2011] / [druckversion artikel] / [archiv: guatemala] |
| [art_4] Venezuela: Kakao / Karibik / Chuao (Bildergalerie) Das 1200 Einwohner zählende Dorf Chuao wurde für seine ursprüngliche koloniale Architektur im Jahr 2002 von der UNESCO ausgezeichnet. Vor allem jedoch ist es berühmt für seinen hervorragenden Kakao. Es verwundert daher nicht, dass man auf der sandigen Straße vom Strand zum Dorf links und rechts nur Kakaopflanzen zu Gesicht bekommt. Zu Fuß benötigt man für die Strecke bis ins Dorf etwa eine Stunde oder man wartet auf den unregelmäßig fahrenden Bus, der wie alle weiteren 20 Autos der Dorfbewohner in einem kleinen Boot über das Meer gebracht werden musste. Auf dem Kirchplatz wird der gepflückte Kakao zum Trocknen ausgelegt und hinter dem Dorf gibt es eine Möglichkeit im Fluss zu baden. Die Kinder Chuaos sind meist schon dort und planschen. Chuao ist nur mit dem Boot zu erreichen. Von Puerto Colombia (Choroní) bis Chuao dauert die Überfahrt 20-30 Minuten.
Bilder: Dirk Klaiber [druckversion ed 08/2011] / [druckversion artikel] / [archiv: venezuela]
|
| [kol_1] Amor: Copacabana im Winter Neid! Das ist wohl das richtige Wort. Während in Deutschland der Sommer absäuft, schwitzen wir im brasilianischen Winter an der Copacabana. Neid! Das hört man am anderen Ende der Leitung, wenn man mit den Lieben in der fernen europäischen Heimat spricht. Warmer Winter hier, kalter Sommer dort.
Beim ersten Kontakt ist das Meer bitterkalt. Doch sobald man einmal abgetaucht ist, ist es nur noch Erfrischung. Von allen Seiten schallen die Rufe der Verkäufer: arabische Leckereien, Mate-Tee (eisgekühlt), Sandwiches, Eis und Kekse. Dazu die obligatorische Kokosnuss mit dem trüben Kokoswasser. Angeblich das gesündeste Getränk der Welt. Egal, uns schmeckt es auf jeden Fall.
Touristen überall. heute werden die Qualifikationsgruppen für die WM 2014 ausgelost. In der Stadt wimmelt es von Polizisten, die die Prominenten in den Hotels schützen sollen. "Kommt Beckenbauer auch?", fragen wir uns… Pelé ist auf jeden Fall da, aber nicht am Strand. Dafür spielen Jungs Futevoley, eine Art Volleyball, gespielt mit Schultern, Brust und Füßen. Jeden Nachmittag trainieren sie hier. "Neid", denken wir uns. Hier wohnen müsste man.
Aber noch geht es uns gut, wir liegen in der Sonne und lauschen den an den Strand auslaufenden Wellen. So müsste Winter immer sein. Von daheim kommt eine SMS. "Schöne Grüße aus dem Planschbecken Deutschland..." Wir können uns nicht beklagen! Text + Fotos: Thomas Milz [druckversion ed 08/2011] / [druckversion artikel] / [archiv: amor] |
|
[kol_2] Erlesen: Dolce & Habana
Castro und Havanna. Eine kubanische Reise von Reinhard Kleist Reinhard Kleist zeichnet Comics, aber nicht irgendwelche Comics, sondern sog. Graphic Novels (Comicromane in Buchformat), die aus den USA kommend nun auch in Deutschland einen Markt finden. Nachdem er bereits erfolgreiche Novels u.a. über Johnny Cash veröffentlicht hatte, reiste er im Jahr 2008 einige Wochen durch Kuba und machte sich dort Notizen und Skizzen. Mit "Havanna. Eine kubanische Reise“ ist eine Mischung aus Reisebericht und Skizzenbuch erschienen, in der er seine Impressionen aus der kubanischen Hauptstadt und deren Umgebung festhält. Klassische Comicpassagen in Schwarz-Weiß oder Farbe wechseln sich mit eindrucksvollen großformatigen Aquarellzeichnungen, z.B. vom Malecón (als Doppelseite), und flüchtigen Skizzen ab. Kleist zeigt die kubanische Lebenswelt in all ihren Facetten: die Schönheit Havannas genauso wie die katastrophale Wohnsituation vieler Habaneros, dunkle Hinterhöfe oder touristische Highlights (Trinidad); er lässt Befürworter und Gegner der Revolution auftreten, meistens in Person zweier älterer Damen. Kleist ist gleichzeitig fasziniert von der Menschlichkeit und der Lebensfreude der Kubaner, andererseits erschrocken über den Polizeistaat, die Armut und den Verfall. Der Erzählstil ist kritisch oder humorvoll, je nachdem wie es passt. Der Leser erfährt, wie man sich in Kuba korrekt beim Bus anstellt oder wie die kubanische Variante der Pizza schmeckt. Kleist ist ein genauer und distanzierter Beobachter, der in seinem Fazit der Reise Humor beweist, wenn er auf der vorletzten Seite die "Vorzüge“ der Freiheit in seiner Heimat darstellt. Und der Leser sollte genau hinsehen, sonst entgehen ihm Feinheiten wie der Spruch auf dem T-Shirt des Cocotaxi-Fahrers: "Dolce & Habana“. Auch vor Fidel Castro macht Kleist keinen Halt. Mit ihm, der ihn großformatig von den Häuserwänden oder Plakaten anblickt, tritt Kleist in eine Art fiktiven Dialog über die Ideen der Revolution und die amerikanische Embargopolitik. Und das brachte den Autor auf die Idee, eine Castro-Biographie zu zeichnen. Mit 280 Seiten ein wahrer Comicroman, rein in Schwarz-Weiß gehalten. In ihm reist der von Reinhard Kleist erfundene Journalist Karl Mertens 1956 nach Kuba, um Castro zu interviewen und schließlich aus Begeisterung dort zu bleiben. Der fiktive Charakter lebt inmitten der Ereignisse und schildert aus seiner Sicht die politische Karriere Castros und das Leben auf Kuba in den 50er und 60er Jahren; nur die letzten dreißig Seiten widmet Kleist den aktuelleren Ereignissen um Castros Rücktritt. Und auch wenn er mit der Liebesgeschichte von Karl und Lara, die sich später in eine Gegnerin der Revolution verwandelt, einen fiktiven Strang in die Geschichte einbaut, bleibt dieser Band vor allem eine beeindruckende Bebilderung historischer Ereignisse, ganz im Gegensatz zu "Havanna“. Text: Torsten Eßer Cover: amazon [druckversion ed 08/2011] / [druckversion artikel] / [archiv: erlesen] |
|
[kol_3] Macht Laune: Tapa zum Bier
Abends komme ich hungrig in Madrid an. "Lass uns essen gehen", schlage ich meiner Freundin vor. "Lass uns Biertrinken. Das macht auch satt", entgegnet sie. Bars, in denen man zum Bier ein paar Mandeln und Oliven bekommt, tauchen vor meinem inneren Auge auf - und ich fühle mich nicht richtig ernst genommen. Wir sitzen in der ersten Bar. Das Publikum ist gemischt: Leute in Anzügen, die gerade von der Arbeit kommen, ältere Leute aus der Nachbarschaft, junge Leute, die Gin-Tonic trinken. Wir ordern eine caña, ein Glas Bier. Dazu bekommen wir eine Stück Tortilla, zum zweiten eingelegte Paprika, zum dritten einen Teller mit Schinken. Ich wäre auch einfach sitzen geblieben, aber meine Freundin ließ nicht mit sich reden: "Der Witz am Tapas-Essen ist das Weiterziehen. Also gehen wir in die nächste Bar, nur etwa 50 Meter weiter, mit einem Zigarettenautomaten auf der einen, einem Zigarettenautomaten auf der anderen Seite und einem Fernseher an der Wand. Ansonsten ist die Einrichtung auf das nötigste beschränkt. Nach einem Teller Gambas (zu Bier 1), einem Teller Käse (zu Bier 2) und einem Teller Oliven (zu Bier 3) ziehen wir weiter. Ich beginne zu ahnen, dass Essengehen bei Bierlaune in Madrid unnötig ist.
Und so bin ich dankbar, dass wir in unserer nächsten Station - einer Bar direkt am Plaza de Chueca - nur ein paar Oliven gereicht bekommen. So gestärkt von einigen Getränken ohne Essenszugabe, beschließen wir, noch kurz in eine Bar zu schauen, die bereits auf dem Nachhauseweg liegt. An der Wand wechseln sich Wallfahrts- und Stierkampffotos mit ausgestopften Stierköpfen ab. Alles wirkt so prototypisch, dass man lauter Japaner und Amerikaner erwartet, aber die Madrilenen selbst sitzen in ihrer eigenen Kulisse. Ein Teller Fischsalat, Sardellen und Oliven runden unsere Drinks ab. Zu den letzen Getränken lehnen wir jedes weitere nicht flüssige Angebot ab, was den Mann hinter der Theke etwas beleidigt dreinschauen lässt. Egal! Denn mit dem Gefühl, nie mehr etwas Essen zu können, fallen wir in unsere Betten. Text + Foto: Damian Schmidt [druckversion ed 08/2011] / [druckversion artikel] / [archiv: macht laune] |
|
[kol_4] Lauschrausch: Villa-Lobos in Jazz / En la imaginación
Otavio Garcia / Fernando Corona Villa-Lobos in Jazz Nabel 6001 Der Schlagzeuger Otavio Garcia und der Pianist Fernando Corona spielen auf ihrem Album "Villa-Lobos in Jazz" eine Mischung aus Jazz, Bossa Nova und Folklore. Es mag seltsam anmuten, dass auf einem so betitelten Album nur ein Titel aus zehn von Villa-Lobos stammt, aber Corona und Garcia haben ihre Hommage eher auf dessen Wurzeln bezogen, die sehr stark von der brasilianischen Folklore geprägt waren. Sie starten jedoch mit einer wunderbar leicht beschwingten Version von Bachs "Air", denn Villa-Lobos war ein Bewunderer dieser Musik, abzulesen an seinen neun "Bachianas Brasileiras", von denen die Jazzmusiker hier die sehr bekannte Nr. 5 interpretieren. Sonst fokussieren sie ihr vom Gitarristen Felipe Poli unterstütztes Spiel auf traditionelle Titel wie "Boi barroso" oder "Passa passa, gavião", die mal mehr, mal weniger verjazzt werden, deren Arrangements (von Garcia) aber immer leichtfüßig daherkommen. Es finden sich eine Samba - die auch Villa-Lobos sehr schätzte - und ein Kinderlied über einen Frosch im Repertoire und ein Stück von Antonio Carlos Jobim. Denn der war auch ein Verehrer von Villa-Lobos und Garcia wiederum ist von beiden Komponisten beeinflußt. Seine Version von "Gabriela", einem sonst sehr schwermütigen, von Sehnsucht und Leid geprägten Liebeslied, kommt etwas weniger getragen daher. Hörenswert! Javier Colina Trio / Silvia Peréz Cruz En la imaginación contrabaix / galileo mc 12661 Barjazz im allerbesten Sinne erreicht uns aus Spanien. Javier Colina, einer der gefragtesten Bassisten auf der iberischen Halbinsel, hegt eine Liebe zu lateinamerikanischer und vor allem zu kubanischer Musik. Schon mit der legendären Sängerin Martirio spielte er ein Album mit jazzigen Versionen kubanischer Lieder ein, nun legt er mit seinem Trio - Albert Sanz am Klavier, Marc Miralta am Schlagzeug, Saxophonist Perico Sambeat als Gast - und der katalanischen Sängerin Silvia Peréz Cruz ein weiteres Album dieser Art vor. Auf "En la imaginación" - ein Titel der kubanischen Komponistin Marta Valdés, der dieses Album gewidmet ist - arrangiert Colina kubanische (und einen mexikanischen) Klassiker wie "La tarde" oder "Debí llorar" neu, immer ausgehend vom zeitgenössischen Jazz. So sind aus - oft schmalzigen - kubanischen Liedern neue Standards des Latin Jazz entstanden, die in intimen Aufnahmen eine wunderbar schummerige Atmosphäre erzeugen und den Hörer in die karibische Nacht entführen. Lohnenswert! Text: Torsten Eßer Cover: amazon [druckversion ed 08/2011] / [druckversion artikel] / [archiv: lauschrausch] |
.