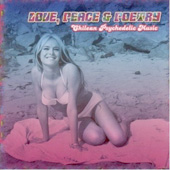ed 02/2009 : caiman.de
kultur- und reisemagazin für lateinamerika, spanien, portugal : [aktuelle ausgabe] / [startseite] / [forum] / [archiv]
|
nicaragua: Vulkanklettern in Nicaragua - Concepción
MARTIN ROSENSTOCK |
[art. 1] | druckversion: [gesamte ausgabe]  |
|
|
brasilien: Davos viel regnet
Das 8. oder 9. Weltsozialforum in Belém THOMAS MILZ |
[art. 2] | ||
|
bolivien: Zu Besuch bei den Yuracaré-Indianern
im bolivianischen Tiefland EVA FUCHS |
[art. 3] | ||
|
spanien: Cadaqués (Romanauszug)
Wenn Dalí noch leben würde MARKUS FRITSCHE |
[art. 4] | ||
|
grenzfall: Ordnung und Graffiti - Die Kunst wird zivilisiert
THOMAS MILZ |
[kol. 1] | ||
|
erlesen: Das Kloster von San Antón.
Der geheimnisvolle Orden der Antonianer JUAN RAMÒN CORPAS MAULEÓN |
[kol. 2] | ||
|
macht laune: Pepe und Pancho
Silvesterflausen und venezolanisch-deutsche Wahlsprüche DIRK KLAIBER |
[kol. 3] | ||
|
lauschrausch: Chilean Psychedelic Music trifft Fado
TORSTEN EßER |
[kol. 4] |
|
[art_1] Nicaragua: Vulkanklettern in Nicaragua - Concepción
Ich ergreife den Stamm eines Baumes und ziehe mich auf eine ausgewaschene Wurzel hinauf. Hier balanciere ich einen Moment auf dem rechten Fuß, bevor ich die Hände gegen die lehmigen Seitenwände drücke, das linke Knie fast am Kinn anwinkele und mich einen weiteren Schritt nach oben hieve. Wir sind auf dem "Wanderpfad", der am Hang des Vulkans Concepción Richtung Gipfel führt. Julio, unser Führer, meinte schon vor der Abfahrt in Mogoyalpa, dass "el camino un poco dificil" sei. Dass es sich um die Abflussrinne des Wassers der Regenzeit handelt, hat er verschwiegen. Es liegen noch gute anderthalb Stunden vor uns. Ich habe gerade mein drittes Gatorade angebrochen, und sowohl T-Shirt als auch Cargo Pants kleben mir förmlich am Körper.
Richie hat sich unserer Gruppe nur angeschlossen, weil er in drei Wochen an einem Rennen um und über die Insel teilnehmen wird und ein bisschen das Terrain sondieren möchte - "just to have a look around", wie er sagt. Richie ist Schotte und arbeitet daheim in der Tourismusbranche. Jetzt ist es dunkel und kalt in Schottland und die Touristen sind weit weg. Deshalb hat er Zeit für das, was er sein Hobby nennt: Extremrennen. Ein Marathon ist, glaubt man Richie, etwas für "wimps", es muss schon ein Triathlon sein. Letztes Jahr hat er am Badwater Rennen teilgenommen, das von Death Valley - dem tiefsten Punkt in den USA - zum Gipfel von Mount Whitney führt, dem höchsten Punkt des Landes, wenn man von Alaska absieht. Und dieses Jahr ist Isla de Ometepe dran: einmal rund um die etwa dreißig Kilometer lange Insel, die erdnussförmig im Lago Cocibolca im Südwesten Nicaraguas liegt. Doch damit nicht genug. Isla de Ometepe wurde durch die Vulkane Concepción und Maderas gebildet. Beide sind etwa 1500 Meter hoch und das Rennen wird knapp unter den beiden Gipfeln vorbeiführen. Mir fällt - während ich auf allen Vieren eine besonders steile Partie hochkraxele - zu so etwas nur noch die Terminologie der Psychoanalyse ein. Ich verschnaufe auf einem Felsblock und beobachte Val (kurz für Valerie) und Matt, zwei Ölingenieure aus Houston. Die zwei geben an der Steigung ebenfalls den aufrechten Gang auf. Ich bin nicht der einzige, der diese Vulkantour unterschätzt hat.
Sie gibt ihm einen Knuff auf den Oberarm. Dann schauen sie mich an, als wäre es nun an mir, ein mehr oder minder geistreiches Wortspiel beizusteuern. Ich will gerade geistlos mit den Achseln zucken, als eine Art Grunzen aus dem Urwald mich davor bewahrt, meinen Mangel an Originalität einzugestehen. Binnen weniger Sekunden schwillt das Grunzen zu einem kontinuierlichen Gebrüll an. Julio taucht an der Wegbiegung auf und winkt uns heran. Als wir drei zu ihm und Richie aufgeschlossen haben, deutet Julio durch eine Lücke im Gebüsch auf den Wipfel eines Baumes, der etwa hundert Meter schräg unter uns am Hang steht. Es dauert eine Weile bis ich die vier, fünf kleinen, dunklen Gestalten erkenne, die auf den Ästen hin und her laufen. Derweil geht das Gebrüll mit unverminderter Lautstärke weiter. "Howler monkeys", sagt Julio. Und dann gibt er eine alte Legende zum besten, dass die Spanier, als sie in Mittelamerika zum ersten Mal an Land gingen und die Laute hörten, die die kleinen Affen produzieren, kehrt machten und zurück zu ihren Schiffen rannten. Nur ein Monster, so glaubten sie, könne solch eine Stimmkraft entwickeln. Während wir unseren Aufstieg fortsetzen, erzählt uns Julio aus seinem Leben, das eng mit der Geschichte Nicaraguas in den letzten vierzig Jahren verwoben ist. Als Dreizehnjähriger war er auf dem Nachhauseweg von einem Baseballspiel. Seine Unterarme waren von Hechtsprüngen schmutzig und aufgeschrammt und so glaubten ein paar Polizisten, er sei in einem Trainingscamp der Rebellen gewesen. Er wurde festgenommen, verhört und gefoltert. Als er nach einigen Monaten immer noch keine Namen genannt hatte, ließ man ihn schließlich auf Betreiben des kanadischen Roten Kreuzes frei, woraufhin er sich sofort den Sandinisten in den Bergen anschloss. Als das Somoza Regime 1979 zusammenbrach, schickten ihn die Parteioberen zur politischen Indoktrination nach Leningrad, "to study Marx", wie er sagt. Doch der russische Winter behagte ihm nicht, und so ging er seinen Vorgesetzten auf die Nerven, bis sie ihn zur weiteren Militärausbildung nach Havanna versetzten. Was er dort lernte, war wahrscheinlich auch nützlicher als Marx, denn inzwischen war zu Hause der Kampf gegen die Contras in vollem Gange. Julio wurde zurück nach Managua beordert, um im Hauptquartier Einsätze gegen die von Washington finanzierten Guerilleros zu planen. "But", und hier macht er eine wegwischende Handbewegung, "all over. No more politics, all corrupt." Die Tatsache, dass es Kanadier waren, die ihn aus den Folterkellern Somozas befreiten, hat ihn dazu inspiriert, Englisch zu lernen. Nun ist dies sein größter Vorteil. Wie viele andere hofft er auf eine boomende Tourismusindustrie in seinem Land. Der kleine Nachbar im Süden ist das große Vorbild: "We will be next Costa Rica."
Während der letzten halben Stunde des Aufstiegs wird es merklich ruhiger. Selbst Richie und Julio, die Unermüdlichen, scheinen es langsam in den Beinen zu merken. Nach und nach dünnt der Regenwald aus und wird schließlich durch Gestrüpp ersetzt. Als wir endlich auf die freie Wiese hinaustreten, erscheinen Klima und Landschaft mit einem Mal alpin. Vor uns liegt die Gipfelregion des Concepción. Die letzten paar hundert Meter sind nackter Basalt. Die Spitze selbst verbirgt sich unter weissen Wolken, die uns über den Boden entgegen zu kriechen scheinen. Es sind keine normalen Wolken. Der Wind, der mit Sturmstärke an den Abhängen herunterrauscht, trägt einen leichten Schwefelgeruch mit sich. Wir stemmen uns gegen die Böen, um die letzten paar Meter zu einem Plateau hinaufzusteigen. Hier ist Schluss. Concepción ist ein aktiver Vulkan, der letzte Ausbruch liegt gerade mal vier Jahre zurück. Zwar juckt es uns alle, bis zum Kraterrand hinaufzusteigen, aber die Vernunft siegt. Auch ohne den Ego-Boost einer Gipfebesteigung hat sich die Quälerei gelohnt. Wir schauen hinunter auf den westlichen Teil der Isla de Ometepe. Die Vulkanasche hat die Insel extrem fruchtbar gemacht. Das ebene Land ist bebaut, entweder mit Bananen, Zuckerrohr oder Kakao. Ein paar Weiden für die seltsam aussehenden Buckelrinder, die in Mittelamerika häufig gezüchtet werden, liegen dazwischen. Der Lago Cocibolca erstreckt sich blaugrau bis zum Festland und jenseits der schmalen Landbrücke kann man mit ein wenig gutem Willen den Pazifik erahnen.
Ob er oft ans Festland geht, will Val von Julio wissen. Er schüttelt den Kopf. "Only if I must." Text + Fotos: Martin Rosenstock |
|
[art_2] Brasilien: Davos viel regnet
Das 8. oder 9. Weltsozialforum in Belém "Eine andere Welt ist möglich" steht auf den über das Stadtzentrum von Belém verteilten Transparenten. Dass diese neue Welt nicht nur möglich, sondern auch nötig ist, wird einem ja schon beim bloßen Blättern durch die Tageszeitung klar: wohin man auch sieht, nichts als Krisen. Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Umweltkrise, Energiekrise, Nahrungsmittelkrise, Trinkwasserkrise, Nahostkrise, nichts ist mehr sicher vor ihnen.
Und so pilgerten etwa 100.000 Menschen in die Stadt im Amazonasdelta, um zu diskutieren, wie die andere und irgendwie krisensicherere Welt denn wohl aussehen solle. Viel mehr Jugendliche als bei den sieben oder acht vorangegangenen Weltsozialforen seien da gewesen, meinte so mancher Veteran der globalen Zivilgesellschaft ausgemacht zu haben. Zu tausenden hausten die Jugendlichen in Zeltlagern auf vom Dauerregen durchweichten Wiesen am Rande der 1,5 Millionenstadt, ließen sich ihre Haare zu Dreadlocks flechten und ihre Körper von Indianern bemalen. "Tropen-Woodstock" raunten manche Zyniker. Währenddessen machten sich in Belém Symptome ach so altbekannter Systemkrisen bemerkbar: endlose Verkehrsstaus erschwerten das Hin-und-Her zwischen den über die Stadt verteilten Tagungsorten, während sich aufgrund fehlender Mülleimer die in den Urwald gebaute "Universidade Rural" in eine Müllkippe verwandelte.
Auf der Suche nach Veranstaltungsorten zogen ganze Karawanen verirrt-verwirrter Teilnehmer kreuz und quer durch die Stadt, nur um, endlich angekommen, festzustellen, dass die versprochene Simultanübersetzung aus Geldmangel nicht stattfindet. Manchmal fehlte es auch ganz banal an funktionierenden Mikrofonen oder adäquaten Räumlichkeiten. Die viel zitierte "andere Welt" hat so ihre Kinderkrankheiten. Und dass der Kapitalismus noch nicht ganz tot ist, wie von vielen Teilnehmern lautstark verkündet, bemerkten die wenigen Glücklichen, die noch eines der 7.000 Hotelbetten ergattert hatten: die Preise wurden einfach verdoppelt und verdreifacht. Auch die wenigen die Stadt anfliegenden Airlines nutzten die Gelegenheit, kräftig aufzuschlagen. So kam das gemeine Fußvolk halt in tagelangen Reisen per Boot oder Bus nach Belém. Die Gesetze des freien Markts sind halt doch nicht so einfach tot zu kriegen. Dabei verkündete Brasiliens Präsident Lula genau das vor 8.000 geladenen Gästen. "Gott Markt ist tot", grollte er ins Mikrofon, und schuld seien die reichen Länder des Nordens, die mit ihrer hausgemachten Casino-Krise ihn nun kurz vor Ende seiner Amtszeit die eigentlich guten Wirtschaftsdaten verhagelten.
Lulas Präsenz war unter den Teilnehmern nicht unumstritten. Zuletzt hatte er 2005 in Porto Alegre teilgenommen, wo er aufgrund seiner Wirtschaftspolitik mit Pfiffen begrüßt wurde. Jetzt ist er zurück, um seine alte Basis zurück zu gewinnen. Gekommen waren auch die Staatschefs aus Paraguay, Bolivien, Ekuador und natürlich der unvermeidliche Hugo Chavez, der sich selbst als Wiedergeburt Che Guevaras feierte und gerne und oft im Namen des kranken Altmeisters Fidel Castro spricht. Gemeinsam nahmen die vier Staatschefs obengenannter Länder an einer unter Führung der Landlosenbewegungen Via Campesina und Movimento Sem Terra organisierten Veranstaltung teil, auf der man die kubanische Revolution hochleben ließ und als Modell zur Rettung der Welt feierte. Mit leuchtenden Augen verfolgten die Überreste der europäischen 68er Generation die feurigen Reden und kamen am Ende sogar noch in den Genuss eines von Chavez und Che Guevaras Tochter gemeinsam angestimmten Kampfliedes. Und als der in seinem Kampfanzug schwitzende Chavez sich auch noch als Feminist outete, kannte die Begeisterung keine Grenzen. Nur bei der Frage, ob es sich nun um das achte oder neunte Weltsozialforum handele, kam der selbsternannte Maximo Lider kurz ins Stocken.
Währenddessen litten die kleinen Basisorganisationen in ihren noch kleineren Ständen unter dem allgemeinen Organisationschaos und dem amazonischen Sommer. Es sei trotzdem gut gewesen, da man viele Netzwerke habe aufbauen können, freuten sich viele. Sie betonten das hohe Niveau der mehr als 2.400 Veranstaltungen, in denen von alternativer Landwirtschaft über Patentrecht bis hin zu neuen Modellen urbaner Sozialarbeit eigentlich alles diskutiert wurde. Brad Pitt und Angelina Jolie seien ebenfalls in der Stadt, mutmaßte man, ohne die beiden zu Gesicht zu bekommen. Dafür sah man den ergrauten Befreiungstheologen Leonardo Boff, der über das Ende des Planeten dozierte und die auch nicht mehr ganz so neue Gaia-Theorie des Herrn Lovelock bemühte. Einig waren sich Boff und Chavez in ihrer Forderung, George W. Bush gehöre vor den Internationalen Strafgerichtshof. Obama sei Dank - dieses Mal kamen die USA erstaunlich glimpflich davon. Im Gegensatz zu den sieben oder acht vorherigen Weltsozialforen gab es wenig Protest gegen die "Imperialisten". Dafür bekam es Israel gleich richtig dick ab. Kaum eine Veranstaltung, auf der nicht der palästinensischen Opfer gedacht und Israel beschimpft wurde. Aber das war im vornehmen Davos auch nicht anders, wo das Ehepaar Pitt-Jolie ebenfalls nicht gesichtet wurde.
In dem mit einem einzigen Klo ausgestatteten Pressezentrum, einer zweckentfremdeten Sporthalle auf dem Universitätsgelände, sitzen jetzt die zahlreichen aus aller Welt angereisten Journalisten und ringen mit ihren Abschlusskommentar und den Tastaturen im ungewohnten belgischen Format, gestiftet von einer NGO aus besagtem Land. Kein einziger Buchstabe ist dort, wo man ihn vermutet. Sie ist nicht unbedingt einfacher, diese andere Welt. Aber wer hat schon wirklich geglaubt, dass dem so wäre? Wahrscheinlich nur Hugo Chavez, der laut verkündete, dass die venezolanische Revolution dabei sei, die Utopie von Thomas Morus in die Tat umzusetzen; 493 Jahre nach ihrer Veröffentlichung, nebenbei bemerkt. Viele wären wohl schon damit zufrieden, ein paar "Reparaturen" am gegenwärtigen System durchsetzen zu können. "Wenn man wollte, könnte man diese Veranstaltung in Grund und Boden schreiben", sagt eine brasilianische Bekannte von mir, die ich zufällig auf dem Kilometer langen Marsch zwischen den Veranstaltungsorten treffe. Aber wer will das schon.
Wir gehen an einer Gruppe brasilianischer Indios vorbei. Über sie und ihre bedrohte Heimat, dem Amazonasregenwald, sollte hier in Belém eigentlich hauptsächlich diskutiert werden. Aber irgendwie hat man sie in all dem Rummel um Lula, Chavez und die Palästinenser mal wieder vergessen. Na ja, vielleicht finden sie ja auf dem nächsten Weltsozialforum Gehör. Das soll allerdings wohl in Afrika stattfinden oder vielleicht sogar in Obamaland. "Eine neue Welt ist möglich!!!" Also bis demnächst auf dem neunten Weltsozialforum. Oder wäre es sogar schon das zehnte? Text + Fotos: Thomas Milz [druckversion ed 02/2009] / [druckversion artikel] / [archiv: brasilien] |
|
[art_3] Bolivien: Zu Besuch bei den Yuracaré-Indianern im bolivianischen Tiefland
"Alles ist cool hier: der Fahrer, der Bus, die Musik" oder: "Bitte nicht auf den Boden spucken"... aber auch wahre Weisheiten wie: "Lieber eine Minute in deinem Leben verlieren, als in einer Minute dein Leben" stehen auf den Stickers geschrieben, an der Tür, die das Passagierabteil vom Chauffeur trennt, im Bus von Cochabamba nach San Gabriel. Und ganz nach diesem Motto kriechen wir den Berg hinunter.
Links und rechts neben der Straße wird es nun immer grüner, bis die letzten Flanken der Anden hinter uns verschwinden und die Luft heiss und feucht wird. Drogengeschäft und Vertreibungen Nach etwa vier Stunden erreichen wir Villa Tunari. Hier endet für die meisten Touristen der Ausflug ins Chapare. Ich hingegen bin auf dem Weg nach Sanandita, einem Dorf der Yuracaré-Indios, einem Indianerstamm im Amazonasgebiet Boliviens. Wir passieren einen Militärkontrollposten ausgangs Villa Tunari. "Crime Scene, Do not cross", steht auf dem Band vor dem Posten. Daneben ein Schild: "Wasser ist Leben. Lass nicht zu, dass sie unsere Flüsse verschmutzen. Sag Nein zu Drogen und Drogenhandel." Dementsprechend wird auch unser Bus von den Soldaten durchsucht. Es könnte ja sein, dass jemand Drogen dabei hat oder Instrumente bzw. Chemikalien, die für die Kokainproduktion verwendet werden. Auf einer holprigen Piste geht es von hier aus weiter nach San Gabriel, dem letzten kleinen Dorf vor dem Nationalpark und Indianerreservat Isiboro-Sécure, wo die Yuracaré wohnen, die ich besuchen werde. Je weiter wir kommen, desto größer sind die Kokafelder am Wegesrand. Einfache Häuser aus Brettern säumen die Straße. Doch arm sind die Leute hier nicht. Vor etlichen Häusern stehen brandneue Autos und auch die Satellitenschüsseln fehlen nicht. Koka scheint ein gutes Geschäft zu sein! Und Koka gedeiht hier wunderbar. Tatsächlich siedeln immer mehr Kokabauern, vorwiegend Quechua und Aymara aus dem Hochland, in dieses Gebiet um. Auf der Suche nach Anbaufläche machen sie auch vor Nationalpark- und Indianerreservats-Grenzen keinen Halt, roden den Regenwald und drängen die Yuracaré-Indianer immer weiter zurück. Die Siedler aufzuhalten ist kaum möglich ohne die Unterstützung der Regierung – mit einem ehemaligen Kokabauern als Präsidenten.
Dschungelabenteuer Und da fahre ich hin! Im Sammeltaxi, zu zwölft eingequetscht in einem normalen PkW, gelangen wir zur Bootsanlegestelle am Rio Isiboro, wo bereits Angehörige der Yuracaré auf mich warten. Sonntag ist Markttag in San Gabriel, und so wurde eingekauft, was der Dschungel nicht bieten kann: Coca Cola, Fanta, Bier und Kekse... Von hier sind es im Einbaum noch knapp 30 Minuten flussabwärts bis zur Anlegestelle bei Sanandita. Die Sonne steht bereits tief am Himmel und taucht den Wald in ein grelloranges Licht. Je weiter wir uns flussabwärts begeben, umso dichter wird der Dschungel am Flussufer. Es wird rasch dunkel hier und das grüne Dickicht wirkt alsbald bedrohlich schwarz. Lediglich das Zirpen der Insekten, der Gesang der Vögel, das regelmäßige Eintauchen des Holzpaddels und das Gleiten unseres Einbaums durch das stille Wasser sind zu hören. Bis vor einer Generation waren die Yuracaré-Indianer herumziehende Jäger und Sammler. Doch so zu leben ist heute nicht mehr möglich, denn das Gebiet schrumpft aufgrund der Invasion der Kokabauern zusehends. Heute sind die Yuracaré sesshaft in Gemeinschaften von 10 bis 30 Familien. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Yuracaré dramatisch auf heute nur noch etwa 150 bis 200 Familien reduziert, von denen 14 in Sanandita leben. Ich werde hier ein paar Tage gleich einem Stammesmitglied mit ihnen leben. Als Unterkunft dient eine einfache, traditionelle Hütte, gebaut aus den Materialien des Urwaldes, ohne einen einzigen Nagel. Eine aus einem Baumstamm gefertigte Treppe führt auf den aus Blättern geflochtenen Zwischenboden, der als Schlafstätte dient. "Hier kommen keine Taranteln oder andere potentiell unangenehme Besucher hoch", erklärt Jhonny, Yuracaré-Indianer und Verantwortlicher des in Sanandita ins Leben gerufenen sogenannten Dual-Tourismus-Projekts, während wir vom Fluss zur Hütte an der Lagune schreiten. Bis wir die Hütte erreichen, ist es bereits Nacht geworden. Bald sind nur noch das Funkeln der Sterne und das Blinken der Glühwürmchen zu sehen. Vom Fischen und Gefischt-Werden Am nächsten Morgen ruft mich Jhonny zum Frühstück bei meiner Gastfamilie. Diese vier Tage verbringe ich mit Don Humberto, seiner Frau und dem jüngsten Sohn, Guido. Ich werde von ihnen sofort aufgenommen wie ein Familienmitglied.
Heute singt jedoch nicht Britney Spears beim Frühstück: Stattdessen ertönen Trompetenfanfaren und militärische Marschmusik, zu der im Takt ein Hahn über den Hof stolziert. Eine der Hauptaktivitäten der Yuracaré ist der Fischfang, und so paddle ich mit Don Humberto im Einbaum den Fluss hoch. In den Baumkronen sehen wir von weitem ein paar Affen herumturnen. Ins Auge fallen mir aber vor allem die flaschenförmigen Nester einer Gruppe Oropendulas, Webervögel. Bald tönt auch ihr merkwürdig gurgelnder Gesang herüber. Uns steht zum Angeln wohlgemerkt keine High-Tech Ausrüstung zur Verfügung. Doch selbst mein erster ungeschickter Auswurf der einfachen Konstruktion aus Silch und Haken genügt, und schon zappelt ein großer Fisch mit silbernem Rücken und oranger Brust an der Angel. Ich scheine Glück zu haben! Das hier ist ein wahrer Fischgrund – ein Traum jedes Fischers. Doch nach meinem Anfängerglück schaue ich nur noch zu, wie Don Humberto einen Fisch nach dem anderen an Bord zieht. Bei mir beissen sie zwar an, doch die Viecher sind stark und der zähe Faden schneidet unerbitterlich in meine zarte Haut, verwöhnt von der Arbeit am Computer. Und so ziehe ich jeweils den Haken ohne Köder wieder heraus. "Das sind die gefrässigen Piranhas", meint Don Humberto lachend, "da musst du schneller sein!" Zurück im Dorf bereite ich mit Don Humbertos Frau unser Mittagessen zu. Gekocht wird mit Wasser aus dem Fluss, auf einer einfachen Feuerstelle. Neben Fisch zählen noch Yucca, wie Maniok hier genannt wird, Bananen, Reis und Mais zu den wichtigsten Nahrungsmitteln. Und so gibt es heute auch einen Eintopf aus Fisch, Bananen und etwas aus San Gabriel importierter Pasta. Für meinen Geschmack ist das Ganze etwas zu salzig und ich spüle jeden Bissen mit dem gesüßten Kräutertee herunter. Anschließend spiele mit dem kleinen Guido stundenlang mit der einzigen Murmel, die er besitzt und seinen zwei kaputten Spielzeugautos. Mit den etwas älteren Kindern gehe ich baden und schwimmen im Fluss. Da es hier keine Duschen oder fließendes Wasser gibt, ist dies die einzige Möglichkeit, mich von den angesammelten Dreckkrusten zu befreien. Was für eine Wohltat! Im Anschluss werde ich von den Kindern zum "Fischen"-Spielen eingeladen. So wird hier unser "Fangen" genannt. Es ist gar nicht so einfach. Im braunen Flusswasser sind die flinken Kinder schnell weggetaucht und winken mir dann plötzlich lachend, hinter dem nächsten Kanu schwimmend, zu. Ich hingegen, von den Kindern liebevoll Gringita genannt, bin ein leichtes Fressen für den jeweiligen "Fischer". Von den Kindern lerne ich auch, wie man ein Einbaum lenkt. Das beherrschen sie hier nämlich schon, bevor sie schwimmen können. Zwei Jungs demonstrieren, wie man mit Pfeil und Bogen die Fische fängt, die sich am Grund der Lagune tummeln, und am Abend werden wir auf Kaimanpirsch gehen. Geduldig erklärt man mir auf dem Rückweg, welche Beeren man essen kann und welche giftig sind, oder welche Pflanzen zum Färben von Tüchern verwendet werden können. Mein grünes T-Shirt wird dabei zum Opfer einer Demonstration. Ein violetter Fleck wird mich jetzt noch lange an die Kräfte der Natur erinnern. Ich erfahre aber auch, wann Koka reif ist zum Pflücken und helfe beim Ausbreiten der Blätter zum Trocknen an der Sonne. Die Yuracaré können heute nicht mehr bloss vom Fischfang leben. Wenn dann die Siedler die Gemeinden dazu drängen, sich ebenfalls dem Kokageschäft zu widmen, ist die Versuchung groß, selber Wald zu roden, um Koka zu pflanzen.
An dem Tag, an dem ich Sanandita wieder verlasse, sehe ich frühmorgens, wie die jungen Männer des Dorfes bewaffnet mit Pfeil, Bogen und Machete losziehen, um ihr Land gegen die Siedler zu verteidigen. Text: Eva Fuchs Fotos: DELPIA Projektinfo: Der Tourismus dient einerseits als Alternative zum Kokaanbau, kann somit weitere Waldrodungen verhindern und schützt so den Regenwald. Ein Grossteil der Einnahmen im Tourismus fliesst direkt in soziale Projekte und kommt so der ganzen Gemeinde zu Gute. Mit Hilfe der Delpia-Stiftung konnten bereits diverse Projekte zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen realisiert werden, wie ein Bienenzuchtprogramm für den Verkauf von Honig oder ein Aufzuchtprogramm von Jochis, einer südamerikanischen Nagetierart ähnlich dem Meerschweinchen. Doch ein genauso wichtiger, wenn nicht noch wichtigerer Faktor ist, dass durch die internationale Aufmerksamkeit der Touristen die Situation der Diskriminierung und Vertreibungen nicht mehr so leicht ignoriert werden kann. Die Touristen werden zur Stimme der Yuracaré. Die Präsenz von ausländischen Reisenden und ihr Interesse an der indianischen Kultur stärkt die Yuracaré zudem in ihrer Identität und in ihrem Stolz für die eigene Kultur – ein wichtiger Faktor für die sonst marginalisierten und unterdrückten Gemeinden.
Reiseinfos: Einreise: Bürger der meisten Länder der Europäischen Union benötigen für einen Aufenthalt bis 30 Tage einen gültigen Reisepass, der noch mind. sechs Monate über das Ausreisedatum gültig sein muss. Vor Ort kann die Aufenthaltsbewilligung problemlos gegen Gebühr um jeweils weitere 30 Tage bis 90 Tage verlängert werden. Gesundheit: Gelbfieberimpfung obligatorisch. Für den Aufenthalt in Sanandita ist neben den üblichen Impfungen auch die Typhus-Schluckimpfung empfohlen. Im Nationalpark Isiboro-Sécure gibt es ein tiefes Malariarisiko, die Mitnahme eines Malaria Medikamentes zur Notfalltherapie ist somit ebenfalls angebracht. Reisen zu den Yuracaré: Koordiniert werden die Touren durch die Non-Profit Organisation DELPIA in Cochabamba: Av. Beijing y Tadeo Haenke (Av. Beijing # 1452), Tel: +591-4-4403138; Handy: +591-72290107; mail: info@fundacion-delpia.org; www.fundacion-delpia.org Der Beginn der Tour ist nach Voranmeldung täglich möglich. Es werden zwei verschiedene Programme angeboten: 1. Das Programm "Das indigene Leben" ermöglicht den Besuchern, am Alltagsleben einer Yuracaré-Familie teilzunehmen. Der Besucher fühlt sich dadurch als Teil der indigenen Gemeinschaft. Die genauen Aktivitäten lassen sich im Voraus nicht genau festlegen, da sie stark vom Interesse der Besucher und dem jeweiligen Tagesgeschehen abhängen. 2. Das Programm "Die indigene Welt" bietet dem Besucher die Möglichkeit, die einzigartige Schönheit und den Artenreichtum in den indigenen Territorien kennenzulernen und zu erleben. Bei einer mehrtägigen Trekking- oder Kanutour durch den Urwald werden die Besucher von indigenen Führern begleitet, die während der Strecke ihr Wissen über das Überleben im Regenwald weitergeben. Kosten: Eine viertägige Tour ab/bis Cochabamba kostet für den Einzelreisenden ca. EUR 135.00, resp. ca. EUR 115.00 pro Person bei zwei Reisenden (Anreise ab Cochabamba mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die indigenen Führer sprechen nur Spanisch und Yuracaré) [druckversion ed 02/2009] / [druckversion artikel] / [archiv: bolivien] |
|
[art_4] Spanien: Cadaqués (Romanauszug)
Wenn Dalí noch leben würde Vor dem Zeitalter der Dampfschiffahrt konnte man sich von Cadaqués aus mit einem Segler nach Amerika einschiffen. Die Umsegelung des nahe bei Cadaqués liegenden Cap de Creus war aufgrund der Strömungen sehr gefährlich. Unterhalb der bizarren Felsformationen lagen unzählige Schiffswracks auf einem der berüchtigsten Felsenfriedhöfe der Costa Brava, der Wilden Küste. Noch bis vor zehn Jahren waren die bergigen Hügel um Cadaqués herum ein bekanntes Weinanbaugebiet. Dann kam die Reblaus und vernichtete alles. Nach und nach verwandelten sich die bergigen Hügel in Olivenhaine, die durch sommerliche Feuersbrünste immer wieder großflächig dezimiert wurden. Helena hatte schon manchmal den Eindruck gehabt, dass das Olivenöl aus dieser Gegend auf den hinteren Zungenpartien einen typischen Weißweinabgang entwickelte.  Jeden Sommer zogen täglich zwanzigtausend Menschen durch Cadaqués, doch nur jeder Zehnte wohnte dort auch im Winter. Um, so wie Helena vor ein paar Stunden, von der Ampurdánebene heraus nach Cadaqués zu kommen, musste man über den Pass von Peni. Vor der Erfindung des Automobils durfte man für diese Strecke fast einen ganzen Tag in staubverhüllten Kutschen absitzen. Heute ging das ganz schnell, nicht wahr Helena? Es sei denn, man kam in der Hochsaison, in der sich um den Berg herum tag-täglich liebend gern ein Stauzentrum für ballungsfreundliche Touristenautos bildete. Dem hitzewallenden Aggressionspegel nach handelte es sich hierbei stets um stark strahlende Wespennester kurz vor dem Gau. Helena hatte das einmal miterlebt. Da mit dem Fahren ohnehin nichts ging, musste sie sich plötzlich in Schlangenlinien durch noch verbale Schlägereien manövrieren. Ampurdán. Cadaqués. Cap de Creus. Umschlossen von nacktem, Salzwasser fressendem Fels und dem permanent daran nagenden Meer. Umschlossen von tausendarmigen Tentakeln zweierzeitlos um sich selbst werbender Heiratskandidaten.  Abgesehen von den Sommermonaten lag Cadaqués zumeist in der halbgefrorenen Wiege des Tramontana, der von Nordwesten her die Seele unnachgiebig einschwärzte. Launisch. Unangenehm. Eisig. Sich unbarmherzig durch Landschaft und den darin wohnenden Puls fräsend. Unter dem Strich ergab das auf Dauer eine überdurchschnittlich hohe Selbstmordrate. Wer sich nicht umbrachte, verfiel einer distanzlosen Abenteuerlust oder verwilderten Ausbruchsorgien. Lebensläufe ähnelten einem Flipperautomaten, der sich auf Teufel komm raus mit exzentrischen Dauerverwucherungen und unmenschlichen Formen von nicht anfassbarem Wahnsinn paarte. Unter den berühmten Malern der letzten Jahrhunderte gab es keinen, der so sehr in EINER Landschaft verhaftet blieb wie Salvador Dali. Die Landschaft seiner Kindheit und Jugend. Die Landschaft, die bis in seine weit ausgedehnte Sterbesequenz hinein seine einzigste Rückzugsmöglichkeit blieb. Ein kleiner Ausschnitt von Catalunya, von Katalonien, gerade einmal fünf auf fünf Kilometer groß. Vom Cap de Creus nach Port Lligat, von Port Lligat nach Cadaqués, von Cadaqués bis zum Cap de Creus. Das magische, surrealistische Dreieck eines Jahrtausends. Dali war nie ein Stück Treibholz gewesen. Die Ampurdánebene inklusive Berg und fünfundzwanzig cadaquéske Quadratkilometer waren sein nicht zu lösender Anker. An ihm rüttelten auch nicht acht Jahre amerikanisches Exil um den Zweiten Weltkrieg herum. Ihn hebelten auch nicht lange Aufenthalte in Paris, London und Florenz aus. Selbst inländische Bürgerkriege konnten ihn nicht lichten. Mit ihm blieb Dali lange Zeit Dali.  Wie oft ruderte er von Port Lligat aus zu den Basaltfelsen des Cap de Creus? Wie oft betrachtete er den Kontrast zwischen silberglänzenden Olivenblättern und rotbrauner Erde, auf der fast teerfarbene Seeigel getrocknet wurden? Wie oft versank er in den graurot bis gelbbraun gefärbten Gesichtern, welche in bestimmten Lichteinfallswinkeln von den scharf geschliffenen Felsenreliefs freigegeben wurden? Dort waren die geologischen Ruinen seiner künstlerischen Auferstehung. Dort lag die magisch gesteinigte Felsenwelt einer morbid statischen Schwermütigkeit, an der die wildherbe Fröhlichkeit einer nicht ruhig zu stellenden Meeresströmung nagte. Dort manifestierten sich allmählich die unumstößlichen Wurzeln eines Manipulationsgenies, eines Besessenen der Extravaganz, eines Maestros des vorbehaltlosen Vertuschens. Dort wuchs ein hemmungsloser Figurenkünstler heran, der einen lebenslangen Pachtvertrag über jede Farbnuance bekommen zu haben schien. Die Familie Dali wohnte zwar in Figueras, es war jedoch eher ihre Sommerresidenz im westlichen Teil von Cadaqués, die den Jugendgelüsten des Künstlers ein Dach über dem Kopf anbot.  Der schüchterne Jugendliche Salvador Dali mit den großen, dunklen Augen, aus denen zutiefste Selbstverunsicherung das Gegenüber in Bilder ohne Rahmen hineiniixierte. Ein Einzelgänger, der nicht die Rambla in Barcelona erobern wollte, sondern sich lieber stundenlang der Selbstbefriedigung hingab. Ein Autoerotiker, der seine hyperaktive, fast hysterische Überspannung selbst regulierte. Natürlich mit einer Überlatte an Schuldgefühlen, hatte doch sein Vater ein äußerst geschlechtstriebiges Mahnmal offen auf dem Klavier ausgestellt. Jeden Tag starrte der junge Dali auf das aufgeklappte Medizinbuch über Geschlechtskrankheiten. Natürlich betrachtete er die detailverliebten, gestochen scharfen Bilder und las die erzieherischen Texte zur Ursachenforschung. Um 1900 war Selbstbefriedigung so etwas wie die häufigste Ursache für jede nur erdenkliche Gattung von Geschlechtskrankheiten. Mit nicht wiedergutzumachenden Nebenwirkungen wie Rückenmarksschwund, Verblödung und Krampfadern im Genitalbereich. Keine leichte Kost fur einen egozentrischen Autoerotiker, der auf der Suche nach sich selbst mehrmals täglich am Klavier vorbeilaufen musste. Text + Fotos: Markus Fritsche Lesetipp: Granada ist ein Auszug aus: Markus Fritsche: Für immer und nie wieder Schardt Verlag in Oldenburg, 1999, ISBN 3-933584-19-1
[druckversion ed 02/2009] / [druckversion artikel] / [archiv: spanien] |
|
[kol_1] Grenzfall: Ordnung und Graffiti - Die Kunst wird zivilisiert
Die wundervolle Stadt São Paulo, Wiege der triumphalen brasilianischen Industrie und der Avantgarde des Brasilholzlandes, ist mal wieder mit Riesenschritten vorgeprescht. Dieses Mal hat man sich dabei sogar gleich selbst überholt. Nachdem man erst einmal erfolgreich mit Outdoors und sonstiger Außenreklame aufgeräumt hat, hat die Stadt jetzt Kurs auf die Zivilisierung der letzten subversiv-künstlerischen Widerstandsnester genommen.
Ein Jahr lang, um genau zu sein das Jahr 2007, war die Stadt aufgrund des Verbotes jeglicher kommerzieller Außenwerbung ziemlich farblos. Doch dann tauchten sie auf, die neuen Farben: Graffitis, eine ganze Menge sogar. Man beeilte sich, sie als Schmierereien zu denunzieren, um ein Motiv zu haben, sie umgehend zu übertünchen. Für die Graffitikünstler boten die von Reklame befreiten Wände der mit Millionen Häusern überladenen Stadt gigantische Leinwände, die es zu füllen galt. Und genau das taten sie auch. Outlaw-Maler, außerhalb des Gesetzes und außer Kontrolle. Als Schocktherapie für sie wurde gleich einmal ein Exempel statuiert und eine minderjährige Sprüherin für 55 Tage in Haft gehalten, nachdem sie das "leere Stockwerk" der Biennale mit Graffitis besprüht hatte.
Obwohl einige der Sprüher berühmt und mit Ausstellungen im Ausland gefeiert wurden, was also für die Galeristen in New York und Paris wie Kunst aussah, war für die örtliche Stadtverwaltung nichts als Schmiererei. So wurden Werke des gefeierten Sprüher-Bruderpaares Otavio und Gustavo Pandolfo, kurz "Osgemeos", die "Zwillinge", entlang der Schnellstraße Avenida Radial Leste kurzerhand getilgt. Was folgte, war ein Aufschrei der Verteidiger der Kunst. Ein Irrtum sei es gewesen, entschuldigte sich die Stadtverwaltung kleinlaut. Das dürfe nicht mehr passieren, schwor man. Und fand die perfekte Lösung für das Dilemma: man wolle nun alle Meisterwerke katalogisieren und in einer Art Kunstführer vereinigt publizieren, der allen, die die zementgraue Stadt nach Farbe und Leben durchsuchten, als Reiseführer dienen solle.
Und für die Angestellten der für die Sauberkeit der "sauberen Stadt" verantwortlichen Dienstleistungsbetriebe werde er als Handbuch dienen, damit man wisse, was als Kunstwerk überleben dürfe und welche Schmierereien zu übermalen seien. Doch damit nicht genug: man wolle die Überführung Elevado Costa e Silva, bekannt als Minhocão, in eine Art Open-Air-Galerie verwandeln, abgesegnet und autorisiert durch den Kunstgeschmack der Stadtverwaltung. Die Kunst zivilisieren sei das Ziel, so wie man ja schon nahezu alle Manifestationen von Leben in dieser ach so organisierten Stadt zivilisiert habe. Die Autofahrer, die sich jeden Tag durch die gigantischen Staus kämpfen, werden dankbar sein. Für sie wird es keine im Stau verlorene Zeit mehr geben; sie werden ihre Aufmerksamkeit der Kunst widmen können.
Der Welt fehlen solch visionäre Lösungen! Es lebe die Avantgarde aus São Paulo! Text + Fotos: Thomas Milz Mehr zu diesem Thema: Stadt ohne Schilder - São Paulo räumt auf Zwischen Kunst und Schmiererei - Graffitti in São Paulo Mut zur Lücke - Die 28. Biennale in São Paulo [druckversion ed 02/2009] / [druckversion artikel] / [archiv: grenzfall] |
|
[kol_2] Erlesen: Das Kloster von San Antón
Der geheimnisvolle Orden der Antonianer Die Ehrfurcht gebietenden Ruinen, die heute als Bauernhof genutzt werden, überdachen wie in Puente la Reina mit ihrem Narthex (dem Vorhof gleich nach dem Eingangsportal) den Camino, der zur Straße geworden ist. Auf der Wand unmittelbar vor dem Narthex kann man das Wappen der Dauphiné, der Heimat der Ordensgründer, und unter dem überwölbten Vordach ein gotisches Portal erkennen. Hinter der Giebelwand der Grundmauer öffnet sich eine wunderbare Rosette, in der man Tau-Kreuze erahnt, die einen Kreis bilden. Das Ruinenensemble hilft uns, die Erinnerung an den legendären Orden wachzurufen, der das Kloster einst bewohnte. Der Orden der Antonianer ist der Nachfolger der "Brüder vom Almosen" und wird zu Beginn des elften Jahrunderts von neun adeligen Rittern aus der französischen Dauphiné gegründet. Von Anbeginn des Ordens besteht seine Hauptaufgabe darin, die Überreste des Heiligen Antonius, des Einsiedlers aus Ägypten, zu suchen und die am Antoniusfeuer (ignis sacer) Erkrankten zu heilen und zu pflegen.
Bei ihren Wanderungen durch Ägypten stellen sie sich unter den Schutz der Heiligen Maria der Ägypterin (heilig und in die Mysterienweisheiten der alexandrinischen Schule eingeweiht) und kommen mit orientalischen Geheimkulten in Berührung. Deshalb sind es wahrscheinlich sie, die in der Tradition des Isiskultes die "Schwarzen Jungfrauen" einführen. Sie schaffen das Sinnbild des T (Tau) bereits hundert Jahre vor den Templern, breiten sich weit über die Dauphiné hinaus aus und treten in Kontakt mit dem Heiligen Römischen Reich, vor allem aber mit dem Deutschen Orden. Bei dieser Expansion ist der Jakobsweg eines ihrer Hauptziele. Die Bewohner Nord- und Zentraleuropas, von einer sehr grausamen endemischen Form des Antoniusfeuers befallen, pilgern in Massen nach Santiago. Während ihres beschwerlichen Weges bitten sie die Patres des Heiligen Antonius, ihre Schmerzen zu lindern, indem sie mit der Spitze ihres Hirtenstabes in Form eines Taus ihre faulenden Gliedmaßen berühren. Die Brüder verteilen an die Kranken auch eine Art kleiner Skapuliere, die sie Tau nennen, und Brot und Wein, die bestimmten Ritualen, in welchen auch der Abtstab (natürlich in der Form eines Taus) eine Rolle spielt, unterzogen werden. Mitunter, wenn auch weniger häufig, verleihen sie gesegnete und mit dem Kreuz des Heiligen versehene Antonius-Glöckchen. Auf diese Weise bessert sich die Krankheit auf dem Weg nach Santiago, bis man sich, dort angekommen, vollständig geheilt sieht. Doch Jahre nach der Rückkehr der Pilger in ihre Heimat bricht die Krankheit erneut aus (zweifellos aufgrund einer neu begangenen Sünde) und verlangt nach einer neuerlichen Wallfahrt, die unweigerlich eine neue Heilung bringt. Womit wieder einmal die wundertätige Kraft des Apostels und des geheimnisvollen Ordens des Heiligen Antonius betont wird. Jahrhunderte später, der Orden ist längst verschwunden, entdeckt die Wissenschaft, dass das Antoniusfeuer eine Gefäßkrankheit ist – heute Ergotismus (Mutterkornerkrankung) genannt – die durch den dauernden Konsum von Roggenbrot verursacht wird, das vom Mutterkornpilz (claviceps purpurea) befallen ist. Vor allem die Bewohner der kalten Regionen Nordeuropas, für gewöhnlich Konsumenten von Roggenbrot, erkrankten an der durch den Pilz verursachten Gefäßverengung. Bei Umstellung ihrer Ernährung auf dem Weg durch mediterrane Gefilde, die vor allem Weizen produzierten und wo Weißbrot verzehrt wurde, gesundeten sie allmählich. Natürlich neben der Placebo-Wunder-Wirkung des antonianischen Abtstabes. Von den Antoniusbrüdern sagt man auch, dass sie, gemeinsam mit den Templern, Träger einer geheimnisvollen Überlieferung seien, die aber heute gänzlich verloren gegangen ist. Einige Autoren behaupten, dass nach dem Untergang der Templer die Klöster der Antoniusbrüder beauftragt wurden, unter strengster Geheimniswahrung deren fabelhafte und exotische Schätze zu bewahren. Die Gründung des einfachen Klosters auf unserem Weg scheint auf Alfons VII. (1146) zurückzugehen; sein Verschwinden geschieht ebenfalls auf königliche Veranlassung. Karl III. erlässt 1789 eine Verordnung zur Auflösung des Ordens und 1791 wird der Konvent geschlossen. Fünfhundertfünfundvierzig prall gefüllte Jahre schweben über diesen verlassenen, mit den bekannten Zeichen der Steinmetze übersäten Steinen. Zwischen Olmillos de Sasamón und Castrojeriz, jedoch außerhalb des Pilgerweges, liegt Villasandino, die Wiege von Antonio Álvarez, jenem Dichter von Schelmenromanen, der zwischen den Regierungszeiten Heinrichs II. und Johanns II. zeitweilig vom Hause Trastámara gefördert wurde. Seine Gedichte, strotzend von frecher Unbekümmertheit, füllen das Liederbuch von Baena:
Text: Juan Ramòn Corpas Mauleón (deutsch von Albert Weindl) Fotos: Sabrina Glasbrenner, Willi Weindl
Der in Estella gebürtige Autor ist ein ausgewiesener Kenner des Jakobsweges und veröffentlichte zahlreiche, mit Preisen ausgezeichnete Werke zum Jakobsweg und zur Geschichte und Kultur Navarras. Er war Mitarbeiter bei verschiedenen Literaturzeitschriften, übernahm 1999 die Generaldirektion des Kultusministeriums Navarras (Cultura-Institución Principe de Viana) und wechselte 2003 als Minister an die Spitze des Ministeriums, ein Amt, das er bis heute innehat. Sein Buch "Curiosidades del Camino de Santiago" erschien 1992 erstmals in Spanien und wurde 1993 und 2004 neu aufgelegt. [druckversion ed 02/2009] / [druckversion artikel] / [archiv: erlesen] |
|
[kol_3] Macht Laune: Pepe und Pancho
Silvesterflausen und venezolanisch-deutsche Wahlsprüche In aller Herren Länder sind Papageien zu mehr oder wenigen treuen Begleitern des Menschen geworden. Einige treffen es weniger gut und fristen ihr Dasein in winzigen Käfigen, andere verbringen den Tag auf der Piratenschulter oder nennen einen großen Garten ihr Terrain, in dem sie mit ihren gestutzten Flügeln herumtollen. Zu letzteren gehören Pepe und Pancho. Obwohl sie Männernamen tragen, hat sich bislang niemand dafür interessiert, ob ihre in Gefangenschaft entstandene Beziehung homosexueller oder doch heterosexueller Natur ist. Ist ja auch gleich. Hauptsache sie mögen und necken sich und hecken gemeinsam alljährlich zu Silvester Streiche aus.
Vor zwei Jahren nutzten sie die Gunst der Stunde, als die Menschen Tag 1 und 2 des Januars den Kopfschmerz im Bett pflegten, und hackten eine gewaltige Bananenstaude – das Prunkstück des Gartens – in Grund und Boden. Im Folgejahr begannen sie über Nacht das Weinen und Schreien der Kinder des Hauses zu imitieren, und zwar just in dem Moment, in dem auch endlich die Kleinste der drei Töchter des Hauses ihre Wütausbrüche reduziert hatte bzw. diese nicht mehr von einem ohrenbetäubenden Lärm begleitet wurden. Nun beginnt einer der beiden Loros täglich um 6.15 Uhr mit einem unglaublich so gar nicht herzzerreißendem Wehklagen: Huuuaaaa, Mama, Huuuuuaaaa, Papa, Huuuuuuaaaaa. Und der andere redet auf ihn ein oder schimpft mit ihm: Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Nuschel, nuschel, nuschel. Sei still, jetzt reicht es. Nuschel, nuschel, nuschel. Schluss jetzt und ab ins Bett. Nuschel, nuschel, nuschel.
Pepe? Ja, schwuler Pancho? Du weißt, was heute für ein Tag ist? Klar, Pancho. Tag der süßen Rache, wie jedes Jahr. – Und? Was heckst du aus? Dieses Jahr mein lieber Tucken-Pepe hat es ein paar Touristen in der Posada, die an den Festivitäten teilnehmen werden. Aha! Und du Pepe, süße Schwester des schwarzen Humors, erinnerst dich doch, was sich dort oben in der Ritze verbirgt! Schließen wir doch eine kleine Wette ab. Pepe wirft einen verstohlenen Blick in Richtung Ritze. Seine Gedanken kreisen aber schon um den Lohn des Wettgewinners: Folgendermaßen wird es kommen: Panchita! Der Verlierer wird auf die Wiese hinabklettern und den Lockvogel spielen für den Mucuchis, den gewaltigen Andenhund mit viel Bernhardiner im Blut und gleichzeitigem Schoßhund der Menschen, so dass der Gewinner ihm ordentlich in den Schwanz hacken kann, sobald der Mucuchis nach dem Lockvogel schnappt. Oh ja! Pancho zeigt sich ganz verzückt ob des Gedankens, dem blöden Vieh, Schmerzen zuzufügen. Oh ja! Meine trollige Pepita. Auf dass er mindestens einen Tag vor Schmerzen jaule. Pepe und Pancho verfallen in ein kurzes inbrünstiges Hundjaulen. Dann schaut Pepe Pancho in die Augen und ermuntert ihn, nach außen hin Gelassenheit ausstrahlend, innerlich aber vor Neugier platzend, endlich Einzelheiten seines durchtriebenen Plans preiszugeben: Prinzessin Einfallspinslerin, schieß schon los. Welch Flausen hegt der göttliche Pancho? Wir werden, sobald die Party im Gange ist, den alten Alagran, den die Ritze bewohnenden Skorpion, unter dem Tisch der Feiernden platzieren. Um den Tisch herum gruppieren sich die Touristen aus Düsseldorf, 2 an der Zahl, die Touristen aus Schwaben, 4 an der Zahl und die beiden Kölner. Jeder von uns nennt eine der drei Volksgruppen. Derjenige von uns beiden, der auf die Gruppe tippt, deren Mitglied als erstes vom alten Alagran gestochen wird, hat gewonnen. Grenzenlos verzückt, den Moment des Stiches kaum noch erwarten könnend, schreit Pepe: Ich will die Schwaben, die haben so einen herrlich geringen Wortschatz. Und auch für Pancho, den großen Sk Kölsch-Fan, fiel die Wahl im Sinne Kommissars Jupp Schatz einfach: Düsseldorf. Pancho, Freund und Freundin mein! Was machen wir mit den Kölnern? Verschonen wir im Falle eines Stichs in kölsches Fleisch den Hund? Wo denkst du hin, lieblich gestutztes Pepe-Flügelchen? Nie im Leben. Dann setzen wir so lange neue Skorpione unter den Tisch, bis es die Schwaben oder Düsseldorfer trifft.
Der Abend naht und die Gäste versammeln sich. Auf dem Grill türmen sich Berge von Rinderfilets und Schweinefiletköpfen. Es wird getrunken und endlich das Fleisch angeschnitten. Die Verzückung der Gäste nutzt Pepe aus und gibt Pancho das Zeichen, den alten Alagran zu platzieren. Es trifft die Düsseldorferin, gleich zweimal. Der erste Stich geht ins Bein, der zweite in die Hand, die automatisch zum Bein gehastet war. Der Schmerz ist heftig, doch er ist nicht zu vergleichen mit dem, den der Mucuchies am nächsten Tag zu erwarten hat. Pepe und Pancho feiern ausgelassen bis es 24 Uhr schlägt. Das neue Jahr wird begrüßt mit Feuerwerkskörpern. Die Menschen egal ob Düsseldorf, Köln oder Schwaben, begleiten die Raketen auf ihren Himmelsstürmen mit Uh! Und Ah!-Rufen. Fassungslos blicken Pepe und Pancho vom höchsten Ast des Avocadobaumes auf die Menschen hernieder. Dann sagt Pepe zu Pancho: ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! Mit dem stark am Intellekt der Wähler Zweifel erhebenden Wahlspruch Uh! Ah! Merkel geht nicht! würde sich wohl auch in Deutschland Politik machen lassen. Text + Fotos: Dirk Klaiber [druckversion ed 02/2009] / [druckversion artikel] / [archiv: macht laune] |
|
[kol_4] Lauschrausch: Chilean Psychedelic Music trifft Fado
Der Fado einer Magierin Mariza Terra EMI / Capitol Es beginnt mit einer Überraschung: "Já me deixou" ("Nun hat sie mich verlassen"), der erste Titel auf Marizas neuem Album, klingt fröhlicher als ein "normaler" Fado. Aber er handelt ja auch davon, wie die Melancholie sie verlässt. Zudem wird das zweite Stück von spanischen Gitarrenklängen eingeleitet. Was ist passiert? Mariza hat während ihrer erst kurzen, aber steilen Karriere, seit ihrem Debutalbum im Jahre 2001, auf ihren Konzertreisen viele Länder und deren (Musik)Kulturen kennen gelernt und natürlich auch viele Musiker. Und diese Erfahrungen verarbeitet sie nun auf "Terra", dessen Titel sowohl für die Verwurzelung in ihrer Heimat stehen kann, aber eben auch für die weltweiten Einflüsse auf ihr musikalisches Schaffen. Die Internationalisierung ihres Fado beginnt mit der Auswahl des Produzenten, dem Flamencogitarristen Javier Limón, der einigen Stücken ein spanisches Flair aufdrückt, verstärkt durch die Percussion seines Landsmanns "El Piraña". Sie setzt sich fort in der Auswahl erstklassiger Gastmusiker aus Brasilien, Großbritannien, Kuba und von den Kapverden. "Beijo de Saudade" ("Melancholicher Kuss"), gesungen im Duett mit dem kapverdischen Sänger Tito Paris, klingt wie ein Stück aus einem Buena-Vista-Album. Und tatsächlich trägt die Morna, das kapverdische Gegenstück zum Fado, Charakterzüge des kubanischen Boleros. Der im Waschzettel gezogene Vergleich von Tito Paris mit Ibrahim Ferrer ist allerdings nicht nachvollziehbar. Ein anderer Kubaner, der vielbeschäftigte Schlagzeuger Horacio "El Negro" Hernández, darf seine Kunst auf drei Titeln präsentieren, u.a. in "Tasco da Mouraria", der an das ärmliche Stadtviertel erinnert, in dem Mariza aufgewachsen ist. Die Erfahrung einer ärmlichen Jugend teilt sie mit der afro-hispanischen Sängerin Concha Buika, die mit gitanos aufwuchs, und deren rauchige Stimme im sehnsuchtsvollen Flamenco "Pequeñas verdades" eine perfekte Ergänzung zu Marizas trauriger Fado-Stimme darstellt. Aber die in Mosambik geborene Portugiesin kann auch anders, wie ihr fast schon fröhlicher Gesang in "Se eu mandasse nas palavras" zeigt. Mariza, die neben vielen Musikpreisen als erste portugiesische Künstlerin eine Nominierung für den Latin-Grammy erhielt, sowie in ihrer Heimat einen Orden für ihre Verdienste um die Verbreitung der portugiesischen Kultur, hat auf "Terra" gleich einer Magierin Musik erschaffen (daher auch das geniale Cover), die zwischen Fado, Jazz und verschiedenen anderen Musikrichtungen der Welt pendelt und dabei aus allen das Beste vereint. Anhänger des traditionellen Fado brauchen sich aber keine Sorge machen. Mariza bleibt im tieftraurigen Genre verwurzelt, dafür sorgen schon die portugiesischen Texter und Komponisten, die für ihre leidende Gesangsstimme Zeilen voller Schmerz, Melancholie, Sehnsucht und Trauer verfasst haben: "Apagando a dor do fim, escondo-me num fado e canto" ("Den Schmerz des Endes auslöschend, verstecke ich mich in einem Fado und singe") singt Mariza in "Alma de vento". Chile psychedelisch Love, Peace and Poetry Chilean Psychedelic Music Normal QDK 049 Die wilden 60er und 70er: Bewußtseinserweiternde Drogen wie LSD waren in Mode und The Doors und andere lieferten den Soundtrack dazu. Kokablätter, Kakteen und Pilze mit halluzigener Wirkung wachsen in Lateinamerika in Reichweite und auch Rockmusik gibt es dort ab den 60ern reichlich. Trotzdem ist es weitestgehend unbekannt, dass auch in Lateinamerika eine Szene existierte, die sich der psychedelischen Musik widmete. Die Reihe "Love, Peace and Poetry" ermöglicht es uns, einen kleinen Einblick in diese Musik zu erhaschen. Auf "Raza", dem zweiten Album der 2001 gegründeten Band, wechseln sich flotte Tanznummern mit eher folkloristischen Titeln ab. Jazzimprovisationen, vor allem der Bläser, ziehen sich durch alle Titel. In ihren Texten beschäftigt sich die Gruppe u.a. in einem ironischen Abgesang mit der Sehnsucht vieler Kolumbianer, in die USA auszuwandern zu "blonden Silikonmäuschen und Ferrarifahrern" ("El hueco") oder in "Calle 19" mit den alltäglichen Morden aufgrund des Bürgerkrieges und der Kriminalität. In dieser Straße in Bogotá trafen sich die Musiker übrigens zum ersten Mal zu Jam-Sessions. Mojarra Electrica produzieren einen interessanten und pulsierenden Stilmix, auch wenn manchmal die textlichen Endlosschleifen etwas nerven ("El hoyo negro"). "Love is the answer" lautet der Refrain bei Kissing Spell, die den Reigen von Psychoperlen eröffnen. Los Jaivas, später durch Protestlieder gegen Pinochet bekannt geworden, spielen einen psychedelischen „Albtraum“ wie aus der Frühzeit von Pink Floyd, während Aguaturbia eher funkige Klänge und ein Gestöhne à la Jane Birkin präsentieren. Rockmusik saß in Chile lange Zeit zwischen den Stühlen: von der Linken als imperialistisch gebrandmarkt und von den Rechten als aussätzig verurteilt. Ein Wunder also, dass es trotzdem gelungen ist, Originalbänder oder Tonträger aufzutreiben, die nicht zerstört wurden (manchmal ist die Tonqualität entsprechend). Wie politisch psychedelische Musik sein kann, zeigen Los Mac's mit ihrem Song "La muerte de mi hermano", in dem ein Maschinengewehr erklingt. 17 Songs aus den Jahren 1967 bis 1974, die sowohl interessante Zeitzeugnisse darstellen, als auch gute Musik, die Spaß macht. Text: Torsten Eßer Fotos: amazon [druckversion ed 02/2009] / [druckversion artikel] / [archiv: lauschrausch] |
Impressum:
caiman.de, Inhaber: Sönke Schönauer und Dirk Klaiber, Köln
Ölbergstraße 30, 50939 Köln, Telefon: 0049 (0)177 4242604
Email: redaktion@caiman.de
Inhaltlich Verantwortliche gemäß § 6 MDStV: Sönke Schönauer und Dirk Klaiber
Redaktion Deutsch: Sönke Schönauer und Dirk Klaiber
Redaktion Spanisch: Dr. Berthold Volberg
Redaktion Portugiesisch: Thomas Milz
Gestaltung: Sönke Schönauer und Dirk Klaiber
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.