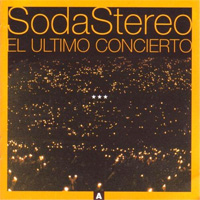ed 01/2015 : caiman.de
kultur- und reisemagazin für lateinamerika, spanien, portugal : [aktuelle ausgabe] / [startseite] / [archiv]
|
spanien: Auf dem Jakobsweg mit Don Carmelo und Cayetana
Sechsundzwanzigste Etappe: O Cebreiro - Druidendorf und Traumpfad über dem Nebelmeer BERTHOLD VOLBERG |
[art. 1] | druckversion: [gesamte ausgabe]  |
|
|
guatemala / panama: Recht auf Familie und elterliche Fürsorge
KATHARINA NICKOLEIT |
[art. 2] | ||
|
argentinien: Mein Leben mit Gustavo Cerati
ANDREAS DAUERER |
[art. 3] | ||
|
panama: Falsche Fische im Gatunsee
Wanderungsbewegungen im Panamakanal KATHARINA NICKOLEIT |
[art. 4] | ||
|
helden brasiliens: Die 7:1-Gesellschaft
Brasiliens Schockstarre nach dem WM-Desaster THOMAS MILZ |
[kol. 1] | ||
|
traubiges:
LARS BORCHERT |
[kol. 2] | ||
|
macht laune: Mit dem Stethoskop durch Morazán
BIRGIT SCHÖNAUER |
[kol. 3] | ||
|
grenzfall: Weihnachten auf den Kanaren - moralisch verwerflich?
BOQUER ONES |
[kol. 4] |
| [art_1] Spanien: Auf dem Jakobsweg mit Don Carmelo und Cayetana Etappen [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] Sechsundzwanzigste Etappe: O Cebreiro - Druidendorf und Traumpfad über dem Nebelmeer Am 26. Juni 2013. Nach einer kurzen aber gottlob schlafintensiven Nacht gelingt uns wie gestern ein früher Aufbruch – und das wird auch nötig sein. Um 6 Uhr verlassen wir die Pilgerherberge von La Faba und treten den bei vielen Santiago-Pilgern gefürchteten Aufstieg nach O Cebreiro an. Der heutige Tag wird uns endlich nach Galizien und zu seinen grünen Wäldern führen, aber auch auf einer Wegstrecke von 26 Kilometern die drei letzten heftigen Aufstiege bereit halten. Es wird also einer der anstrengendsten Tage des gesamten Jakobsweges – aber vielleicht auch der schönste. Zunächst wirkt alles wie eine Kopie des gestrigen Tagesanfangs. Idyllische Umgebung bei Dämmerlicht kurz vor Sonnenaufgang, ein grauenhaft steiler Aufstieg, Cayetanas übliche Morgenklage.
Als die Sonne aufgeht, stehen wir noch nicht auf dem Gipfel des Bergpasses von Cebreiro, sondern – vor einem Misthaufen neben einem Kuhstall. Die ersten Sonnenstrahlen begleiten uns auf dem keuchenden Endspurt zum 1306 Meter hohen Pass von O Cebreiro. Ziemlich außer Atem stehen wir vor dem düsteren Gipfelkreuz aus Granit und frieren. Hier oben weht selbst im Hochsommer am frühen Morgen ein eiskalter Wind. Da wir beim Aufstieg sehr ins Schwitzen gekommen sind, reagieren wir besonders empfindlich auf die plötzliche Kälte und vermögen kaum zu verweilen, um die Aussicht zu genießen. "Bloß raus aus diesem Sturm!", brüllt Cayetana mir ins Ohr. "Und wo ist nun endlich das geheimnisvolle Druidendorf, das du mir versprochen hast?" Direkt hinter uns, schemenhaft verhüllt von Nebelschwaden, die sie langsam freigeben, erscheinen die meist rund gemauerten Steinhäuser von O Cebreiro mir ihren pyramidenförmigen Strohdächern.
Auf dem schnellsten Weg steuern wir die einzige Bar an, die schon um 7 Uhr geöffnet hat. Und die wird gerade gestürmt von Pilgern, die alle aus Sturm und Nebel hinein flüchten. Dazu kommen die etwa hundert Pilger, die hier in diesem Museumsdorf übernachtet haben. Zwei tapfere Thekenkräfte und eine einsame Kaffeemaschine sind damit verständlicher Weise überfordert. Eine Alternative gibt es nicht, denn ohne heißen Kaffee und mit nüchternem Magen zurück in den Sturm kommt nicht in Frage. Kurz gesagt: wir warten fast eine halbe Stunde, bis wir endlich zwei Tassen Milchkaffee und Tarta de Santiago vor uns stehen haben. Nach dem Frühstück erkunden wir das "Druidendorf". Die Nebel sind weitgehend verschwunden und der Wind hat deutlich nachgelassen. Die charakteristischen strohgedeckten Rundhäuser von O Cebreiro sind keltischen Ursprungs, aber heute ist jedes Haus in diesem Freilichtmuseum entweder Pilgerherberge oder Souvenirladen. Außer dem Haus Gottes, das alle überragt. Wir stehen vor den burgartigen Mauern der ältesten Kirche des ganzen Jakobswegs, die hier am Eingangstor nach Galizien in einem Ausläufer des Kantabrischen Gebirges seit fast 1200 Jahren Stürmen, Nebel und im Winter oft meterhohem Schnee trotzt.
Als wir in diesen vorromanischen, fast schmucklosen Tempel eintreten, fühlen wir uns beide in der mystischen Atmosphäre an die Templer-Kapelle von Eunate erinnert. Hier in Santa María la Real hat sich Ende des 12. Jahrhunderts ein Wunder ereignet. In einer eiskalten Winternacht erklomm ein armer Bauer den steilen Pfad zur Kirche, um an der Abendmesse teilzunehmen. Der faule Priester hatte wenig Lust, für einen Einzelnen die Messe zu zelebrieren und fragte den Gläubigen, warum er bei solchem Unwetter herauf gestiegen sei, nur um etwas Brot und Wein zu sehen. In diesem Moment verwandelten sich Hostien und Wein auf dem Altar in Fleisch und Blut. In der rechten Seitenkapelle der Kirche wird der Gralskelch dieses Wunders aufbewahrt und darüber wacht die Virgen del Milagro mit neugierigem Gesichtsausdruck. Im linken Seitenschiff steht einsam eine Statue des heiligen Franziskus, der von vielen brennenden Wünschen umgeben ist – Kerzenflammen, von Pilgern entzündet, die an diesem geheimnisvollen Ort um etwas bitten. Auch Cayetana nimmt jetzt eine Kerze und lässt sie an einer anderen entflammen. Dann kniet sie sich tatsächlich hin (das hat sie seit Eunate nicht mehr getan…), blickt der Statue ins Gesicht und verharrt eine halbe Ewigkeit leise flüsternd, kaum die Lippen bewegend. Neugierig frage ich Cayetana beim Hinausgehen, wofür sie denn vor der Franziskus-Statue so erstaunlich lange gebetet habe. Ihre Antwort kommt prompt und würde manchen Kirchenmann erbleichen lassen: "Für Papst Franziskus – damit Gott ihn beschützt und dafür sorgt, dass er die Giftanschläge des Opus Dei und der Vatikan-Mafia überlebt!"
Es fällt uns schwer, uns von dem "Druidendorf" O Cebreiro zu verabschieden. Es ist zwar ein sehr touristischer, aber auch einzigartiger Ort. Ein unsichtbares Magnetfeld scheint uns hier zurück zu halten. Cayetana (sie ist heute beängstigend nachdenklich) verweilt schweigend vor einem Schaufenster, in dem hunderte von magischen Amuletten mit keltischen Mustern präsentiert werden. Endlich wählt sie eins aus. Sie hängt es sich um und betrachtet fasziniert die kunstvoll verschlungenen Linien auf dem himmelblauen Kreis. Ihr Gesichtsausdruck wirkt merkwürdig abwesend, wie unter Hypnose und als ich endlich wage, sie aus ihrer Trance zu wecken und zu fragen, ob der Verkäufer ihr die Bedeutung des Amuletts erklärt habe, antwortet sie stolz und entschieden: "Diese kreisförmige Verknotung von drei unendlichen Linien ist das Zeichen für den Wunsch nach Perfektion!" Nachdem ich meine Sprachlosigkeit runter geschluckt habe, kann ich mein Erstaunen nur noch hinter leisem Spott verbergen: "Also ne Nummer kleiner haben wir`s heute wohl nicht?"
Unmittelbar hinter dem Ortsausgang von O Cebreiro führt der Weg kurz steil bergan und gibt dann den Blick frei auf grüne Unendlichkeit. Schon die Aussicht zurück nach Südosten war atemberaubend. Aber das Panorama, das sich nun plötzlich Richtung Nordwesten unter uns ausbreitet, ist ein Schock der Schönheit. Es ist, als ob die Welt uns wie am ersten Schöpfungstag zu Füßen liege. Noch unberührt, langsam auftauchend aus einem Nebelmeer, von Licht überflutete, paradiesisch grüne Hügel treiben wie schwimmende Inseln rund um den blaugelben Wegweiser mit den zwölf Sternen. Lautes Schluchzen an meiner Seite reißt mich aus meiner Landschaftsmeditation. Tränenüberströmt starrt Cayetana neben mir in die Tiefe. "Aber was hast Du denn jetzt plötzlich, um Himmels willen?", frage ich sie. Sie greift nach ihrem neuem Talisman. Es vergeht eine lange Minute, bevor sie antworten kann: "Die Welt da unten …ist so krass schön. Das…sieht von hier aus, als ob wir über der Erde schwebten – wie Engel." Meine Weggefährtin erstaunt mich immer wieder. Zuerst wäre sie Mitte Juni beinahe zu einem weiteren Dolce Vita Urlaub nach Ibiza geflogen, bevor sie last minute stornierte und sich plötzlich entschloss, mich doch die zweite Hälfte des Weges ab Burgos zu begleiten. Und jetzt steht sie hier über dem Abgrund, heult sich die Seele aus dem Leib und weiß nicht mal warum – offenbar nach Eunate ihre zweite mystische Ekstase.
Nach diesem Höhepunkt folgt ein Marsch, der uns trotz anstrengender Abschnitte erscheint wie Traumwandeln durch eine waldreiche Bilderbuchlandschaft. Der Anstieg zum Alto de San Roque ist kaum der Rede wert, so beschwingt geht es bei bestem Wetter mit Sonne und 28° Grad vorwärts. Bis wir vor der dritten und letzten Bergetappe des heutigen Tages stehen, die uns auf den Alto de Poio führen wird (1337 Meter). Auf dem Gipfel lockt schon die Reklametafel der Bar mit "Tostadas und Raciones" – sehr werbewirksam, weil man diese Reklame beim ganzen Aufstieg im Blick hat. Während wir den Hügel hinauf keuchen, verspreche ich Cayetana, dass dies definitiv die letzte steile Bergetappe unserer Pilgerreise ist. "Das sagst du immer – aber garantiert geht es nach der nächsten Kurve schon wieder steil bergauf!", kommentiert meine Begleiterin ungläubig. Es folgt ein langer Abstieg über Feldwege, vorbei an friedlich grasenden Kühen und zufriedenen Ziegen. Im Dörfchen Ramil erwartet uns ein Naturmonument: einer der ältesten Kastanienbäume Spaniens. Sein genaues Alter ist schwer zu schätzen, aber der bizarr verknotete Stamm wirkt wie ein expressionistisches Kunstwerk.
Endlich erreichen wir zur Zeit der Siesta unser Tagesziel Triacastela. Die ersten beiden Pilgerherbergen sind schon voll, wir quartieren uns in der dritten ein und halten eine kurze Siesta, nachdem wir vereinbart haben, zusammen die Pilgermesse im Ort zu besuchen. Als wir uns um 19 Uhr der Kirche von Triacastela nähern, kommen uns die Pilgerkollegen in Scharen entgegen: die Pilgermesse war um eine Stunde vorverlegt worden! Cayetana ist nicht unfroh darüber, denn sie hatte Angst davor, übersetzen zu müssen wie gestern in La Faba. Wir begeben uns zurück zur Pilgerherberge, setzen uns auf die Terrasse und lassen den gefühlsintensiven Tag mit Blick auf die ultragrüne galizische Landschaft ringsumher ausklingen. Und auf den letzten fünf Tagesetappen bis Santiago werden wir monumentale Kirchen kaum vermissen, denn eines wird uns klar werden: die eigentliche Kathedrale von Galizien ist der Wald. Text und Fotos: Berthold Volberg Tipps und Links: Etappe von La Faba über O Cebreiro nach Triacastela: 26,5 Kilometer www.redalberguessantiago.com Unterkunft und Verpflegung: Übernachtung / Verpflegung in Triacastela: Private Pilgerherberge "Berce do Caminho", Rúa Camilo José Cela 11 Tel. 982-548127 Küche, Waschmaschine, Internet, Getränkeautomaten, Aufenthaltsraum mit TV, große Terrasse. Freundliche Aufnahme, keine Sperrstunde. Übernachtung 8 Euro. Verpflegung in Fonfría: Bar / Restaurant "Casa Lucas": Pilgermenü (3 Gänge inkl. Wein): 10 - 12 Euro (z.B. Linseneintopf, Fischfrikadellen, Cebreiro-Käse). Sehr empfehlenswert, sehr freundliche Bedienung und das Essen köstlich und großzügig Verpflegung in Triacastela: Restaurant "Complexo Xacobeo" (auch Pilgerherberge): Pilgermenü (3 Gänge inkl. Wein): 10 Euro, sehr gut. Hier haben wir uns statt dem Menü-Wein eine Flasche "Rectoral de Amandis" (Mencía-Rotwein der D.O. Ribeira Sacra, Galizien) gegönnt (8 Euro war für diesen großartigen Wein ein Spottpreis). www.complexoxacobeo.com Souvenirs: im "Druiden-Museumsdorf" O Cebreiro ist jedes der höchstens ein Dutzend Häuser entweder Bar / Herberge oder Souvenirladen. Der beste Souvenirladen ist: "Grialia": große Auswahl hat dieser nach dem heiligen Gral benannte Laden, freundliche Bedienung trotz großen Andrangs, enorme Auswahl an "mystischen" Amuletten mit Bedeutungserklärung und Schmuck. E-mail: grialart@gmail.com Kirchen: O Cebreiro: Kirche "Santa María la Real": gilt als die älteste Kirche des ganzen Jakobswegs, erbaut im 9. Jahrhundert (!), z. T. vorromanisch, einfach und erhaben, mystische Atmosphäre. Im rechten Seitenschiff die "Jungfrau des Wunders" (Virgen del Milagro) und der Kelch des Wunders, im linken die Franziskus-Statue. Kirche Santiago in Triacastela: gotische Pfarrkirche mit romanischer Apsis und barockem Turm. [druckversion ed 01/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: spanien]
|
| [art_2] Guatemala / Panama: Recht auf Familie und elterliche Fürsorge In den USA gibt es eine heftige Diskussion darüber, wie man mit Kinder umgehen soll, die sich alleine von Mittelamerika quer durch Mexiko auf den gefährlichen Weg in die USA aufmachen, um dort bei ihren Eltern zu leben. Kann man sie einfach zurück schicken? Die Meinungen sind gespalten, denn diese Kinder fordern im Grunde nur ein Recht ein, dass ihnen die UN-Kinderrechtskonvention zugesteht: Das Recht auf eine Familie und elterliche Fürsorge. Ihre Geschwister spielen schon draußen, doch Katharina sitzt an ihrem Schreibtisch und macht Hausaufgaben. Sie trägt noch ihre blaue Schuluniform, ihre langen schwarzen Haare sind zu zwei ordentlichen Zöpfen geflochten. Immer wenn sie aufschaut, sieht sie auf das Foto ihrer Eltern. Manchmal bleibt ihr Blick daran hängen und verliert sich dann in der Ferne. Die 13-Jährige hat ihre Eltern zum letzten Mal vor drei Jahren gesehen: 'Meine Eltern leben in Boston in den USA. Sie wollen uns ein besseres Leben ermöglichen und dazu müssen sie Geld verdienen - vor allem das Schulgeld, für mich und meine Geschwister. Doch es macht mich traurig, dass sie nicht bei uns sein können.' Katharina lebt in Santa Teresa, einem kleinen Dorf im Norden Guatemalas, in dem nur selten ein Auto die Hühner von der Straße scheucht. Das Haus, in dem sie wohnt, ist gemauert, die Großmutter kann reichlich Essen auftischen und das Schulgeld wird pünktlich bezahlt. Nichts davon könnten Katharinas Eltern finanzieren, wenn sie in ihrer Heimat geblieben wären. Dann hätten sie weiter als Tagelöhner auf der Kaffeefarm des Großgrundbesitzers arbeiten, genau wie all die Anderen. Katharinas Eltern haben die Schule nur bis zur 6. Klasse besucht. Mit 12 Jahren standen sie bereits auf der Plantage. Ihre Kinder sollten es einmal besser haben. Deshalb machten sie sich auf die gefährliche Reise quer durch Mexiko in die USA. Katharina und ihre beiden Geschwister, den neunjährigen Gabriél und die elf Jahre alte Anna, ließen sie bei den Großeltern zurück. Doch die Familie ist kein Einzelfall. 'Es gibt bei uns im Dorf viele Kinder, die bei ihren Großeltern leben. Manchen Kindern geht es dabei nicht gut, denn sie verstehen sich mit ihrer Oma und ihrem Opa nicht. Ich danke Gott dafür, dass er mir gute Großeltern gegeben hat, die sich wirklich um uns kümmern. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe, als wenn unsere Eltern hier wären. Meine Geschwister und ich fühlen uns schon oft einsam', erzählt Katharina. Als Katharina das erzählt, werden ihr Augen feucht und sie wischt sich verschämt mit dem Ärmel darüber. Aber sie bleibt tapfer sitzen, vielleicht auch, weil Pater Fidel Miranda mit ihr in dem kahlen Wohnzimmer der Großeltern sitzt. Er kennt Katharina seit vielen Jahren und er ist für sie nicht nur Seelsorger, sondern auch ein wenig Vaterersatz – so wie für unendlich viele andere Kinder in seiner Diözese San Pablo. "Ich schätze, dass etwa von der Hälfte der Kinder hier entweder beide Eltern oder zumindest ein Elternteil in den Vereinigten Staaten sind. Die Kinder leben bei ihren Großeltern, bei Onkel oder Tante, manchmal bei den älteren Geschwistern. Aber im Grunde sind sie alleine. Sie haben zwar zumeist etwas Geld und mehr Sachen als andere Kinder, aber sie sagen mir oft, dass sie eigentlich Zuneigung brauchen, jemand, der ihnen zuhört, Zärtlichkeit. Die Elternliebe ist einzigartig, nichts kann sie ersetzen". Fidel Miranda ist Mitte 30, er trägt Jeans und ein schwarzes Hemd, darüber eine Lederjacke. Dass er Priester ist, erkennt man nur an dem weißen Kolar an seinem Kragen. Er hat in der eigenen Familie erlebt, wie sehr den Kindern die Eltern fehlen und wie schwierig es ist, sie zu ersetzen. Als Seelsorger tut es ihm in der Seele weh, dass er oft keine Antworten auf die Fragen der Kinder hat: "Sie sind sehr verletzt. Sie können nicht begreifen, warum die Eltern sie verlassen haben. Vom Verstand her vielleicht schon, aber nicht vom Gefühl her. Ich sage ihnen dann 'schau, deine Eltern sind weggegangen um zu arbeiten, damit du eine bessere Ausbildung bekommst, weil sie wollen, dass es dir später besser geht.' Aber für die Kinder ist das keine ausreichende Antwort. 2000 Kilometer weiter südlich. Die Provinzhauptstadt Santiago de Veraquas in Panama. Im Aufenthaltsraum von 'Nutrehogar' krabbeln 35 Kleinkinder herum, manche versuchen sich an ihren ersten Schritten. Auf dem Boden liegt Plastikspielzeug und im Fernseher läuft ein Disneycartoon, auf den einige der Kinder wie gebannt starren. 'Nutrehogar' ist eine Aufpäppelstation für unterernährte Kinder. Ein katholischer Bischof aus der Gegend hat sie gegründet, alles wird durch Spenden finanziert. Carlos Martinez ist der Kinderarzt hier, er untersucht gerade die kleine Edelca. Sie hat schütteres, glanzloses Haar und ihre Arme und Beine wirken wie trockene, leicht zerbrechliche Äste. Mit ihren zwei Jahren wiegt Edelca knapp sieben Kilo – das bringt ein deutsches Kind normalerweise mit fünf Monaten auf die Waage. Carlos Martinez stellt sie auf den Untersuchungstisch und testet, ob die Beinchen das Gewicht des Mädchens tragen können. 'Dieses Mädchen ist ein gutes Beispiel dafür, in welchem Zustand die Kinder hier her kommen. Sie sind sehr dünn und haben kaum Muskelmasse an Armen und Beinen. Es ist normal, dass sie mit zwei Jahren noch nicht laufen oder nicht einmal krabbeln können. Dazu haben sie einfach nicht die Kraft. Das liegt an ihrer Ernährung, sie bekommen keine Proteine, nur Kohlehydrate und davon zu wenig', erklärt der Arzt. Die Kinder bei 'Nutrehogar' sind zwischen sechs Monate und fünf Jahre alt. Sie bleiben mindestens ein halbes Jahr in der Aufpäppelstation. Ausgerechnet in dem Alter, in dem sie am dringendsten ihre Mütter brauchen, kommen sie in eine völlig fremde Umgebung, zu völlig fremden Menschen. 'Wenn die Kinder hier her kommen, dann weinen sie viel. Sie rufen nach ihren Müttern und das ist für alle schrecklich, denn wir wissen ja, dass ein Kind in diesem Alter zu seiner Mutter gehört. Aber wir müssen abwägen: Schicken wir sie in die Dörfer zurück, wo sie womöglich sterben – oder behalten wir sie hier, bis sie in einem besseren Zustand sind?', berichtet Dr. Carlos. Lebensmittel sind in Panama fast so teuer wie in Europa, doch die Menschen auf dem Land verdienen als Tagelöhner viel zu wenig, um ausreichend Essen kaufen zu können – da helfen auch die monatlichen 50 US-Dollar Sozialhilfe pro Familie nicht viel weiter. Und so liefern verzweifelte Mütter ihre fast verhungerten Kinder in der Gesundheitsstation ein. Die extremsten Fälle werden zu 'Nutrehogar' geschickt – auch wenn die Trennung schwer fällt. 'Wenn sie länger hier sind, verlieren sie völlig den Kontakt zu ihrer Familie. Meistens erkennen sie irgendwann ihre Mütter nicht wieder. Und oft erkennen auch die Mütter ihre Kinder nicht mehr. Sie können sie so oft besuchen, wie sie wollen, aber die meisten kommen nur etwa alle drei Monate, denn die Bustickets sind sehr teuer. Unsere Institution bezahlt zwar ab und zu Anreisen, aber uns fehlen eigentlich die finanziellen Mittel dafür. Dabei ist es so wichtig, dass der Kontakt zur Familie nicht abreißt!', schildert der Mediziner die Situation. Was passiert mit Kindern, die ohne ihre Eltern aufwachsen müssen? Für Pater Fidel Miranda aus San Pablo in Guatemala sind Familien die Kernzellen der Gesellschaft. Wo sie fehlen, entstehe ein Vakuum, sagt er. "Es gibt bei uns eine ganze Generation von Kindern, deren Eltern ausgewandert sind und inzwischen werden die Konsequenzen sichtbar: Eine unmenschliche Gesellschaft, in der alle Werte verloren gehen. Diese Kinder haben niemanden, der sie leitet, an dem sie sich orientieren können. Und vor allem niemanden, dem sie wirklich wichtig sind. Viele dieser Kinder schließen sich Jugendgangs an." In ganz Mittelamerika ersetzen oft Jugendgangs, 'Maras' genannt, den verlassenen Kindern ihre Familien. Aufgewachsen ohne Halt und ohne Liebe, sind die Mitglieder der Maras für ihre Brutalität und Gewissenlosigkeit bekannt. Oft arbeiten sie für Drogenkartelle und haben ganze Stadtteile unter ihrer Kontrolle. Fidel Miranda fühlt sich bei dieser Konkurrenz oft machtlos. "Ich versuche, den Kindern so gut es geht die Eltern zu ersetzen. Manchmal nehme ich sie in den Arm und halte sie einfach nur fest. Und ich sage ihnen, dass Gott, unser Vater im Himmel, noch größer ist als unsere Eltern auf der Erde. Aber vor allem die Jüngeren fragen dann: 'Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht.' Es ist sehr schwierig, darauf Antworten zu finden." Wenn es gut läuft, bleibt der Kontakt zu den Eltern trotz der vielen tausend Kilometer Entfernung erhalten. Die ganze Wand über Katharinas Bett ist vollgeklebt mit Fotos ihrer Eltern. Auf manchen Bildern ist auch ein Baby zu sehen - seit einem Jahr haben Katharina und ihre Geschwister noch eine kleine Schwester. Sie heißt Carla und wurde in den USA geboren. "Ich kenne sie nur von Fotos. Manchmal rufen wir sie an und sagen 'Hallo Carlita, wie geht es Dir?' und dann singen wir ihr Kinderlieder vor. Es ist so schön, sie lachen zu hören und sie kann sogar schon Papa sagen", erzählt Katharina. Wenn Katharina von ihrer Schwester spricht, die sie noch nie im Arm gehalten hat, dann kommt plötzlich Leben in das sonst so traurige Mädchen. Fast so, als könnte die kleine Carla stellvertretend für ihre Geschwister die Liebe der Eltern genießen und weitergeben. "Meine Eltern haben uns ganz oft gesagt, dass wir alle einen besonderen Platz in ihrem Herzen und sie uns alle gleich lieb haben. Und sie haben uns versprochen, dass wir uns eines Tages wieder sehen. Wir hoffen, dass dieser Tag wirklich kommt. Denn uns fehlt die Liebe unserer Eltern sehr." Text: Katharina Nickoleit Weitere Informationen über die Autorin findet ihr unter: www.katharina-nickoleit.de [druckversion ed 01/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: guatemala panama] |
| [art_3] Argentinien: Mein Leben mit Gustavo Cerati Ich kann mich noch genau erinnern, wie wir uns kennen gelernt haben, Gustavo Cerati und ich. Es war über meine Freundin Ana, die sich bei mir für die mitgebrachten Empanadas zum Mittagstisch mit einem Gracias totales bedankt hatte. Jenem Ausdruck also, der in die argentinische Musikgeschichte einging wie kein anderer und den Gustavo Cerati nach dem Schlussakkord von seiner wohl bekanntesten Hymne, De música ligera, der Menge im River-Stadion entgegen schleuderte. Gracias totales, wir sind jetzt weg. Mit ‚wir‘ war Ceratis emblematische Band Soda Stereo gemeint, die sich am 20. September 1997 mit ihrem letzten Konzert in Buenos Aires von ihren Fans verabschieden sollte. Zumindest vorerst, denn im Zuge unzähliger Wiederbelebungsversuche diverser Bands sprangen auch die drei Herren Gustavo Cerati, Zeta Bosio und Charly Alberti auf den Revival-Wagon auf und gingen zehn Jahre später doch noch einmal gemeinsam auf Tour quer durch den amerikanischen Kontinent. Dass sie dabei ein Millionenpublikum in glückliche Ekstase versetzten, war fast schon nebensächlich. Ruhm verjährt manchmal, aber nicht im Falle dieses Trios.
Die erste Scheibe steckt in einem orangenen Rahmen, die zweite in einem blauen. Dazwischen erahnt man in Schwarz eine frenetische Menge, die Wunderkerzen und Feuerzeuge in die Höhe hält und 15 Jahre Bandgeschichte bejubeln durfte. Ich indes war sofort gefangen von einem Sound irgendwo zwischen Pop und Rock, zwischen Post-Punk, New Wave, zwischen Ska, R&B und Soul stets vor einem ebenso frischen, wie eigenwilligen Klangteppich, deren Architekt - natürlich - Cerati selbst war. Ein akribischer Arbeiter, sämtlichen neuen musikalischen Strömungen aufgeschlossen, alles ausprobierend und damit mit seiner Band Anfang der 1980er schlicht und ergreifend zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Die Diktatur bröckelte, im Volk gärte es und alle Kreativität fiel auf fruchtbaren Boden.
1982 tourte man zwei Jahre durch die Clubs, 1984 folgte die erste offizielle Scheibe Soda Stereo. Ironische, durchaus sozialkritische Texte wie Te hacen falta vitaminas, ¿Por Qué No Puedo Ser Del Jet-Set? aber auch Sobredosis de TV. Im Jahr danach folgte Nada Personal und 1986 bereits Signos, mit der gleichnamigen Singleauskopplung und dem viel beachteten Track Persiana Americana. Die Tour zur dritten Platte führte die Band quer durch Lateinamerika und ein Jahr später kürte der Rolling Stone das ausgekoppelte Live-Album Ruido Blanco zu einem der fünf besten Live-Alben Argentiniens. Bis zur Trennung 1997 folgten vier weitere Studioalben und Soda Stereo mit ihrem charismatischen Frontman Cerati waren längst zur erfolgreichsten Band Lateinamerikas geworden.
En la Ciudad de la furia war mein Song für Buenos Aires. Wer einmal die Hauptstadt im Sommer unter sengender, unerbittlicher Hitze hat erleben müssen, dem wird dieser Song immer wieder in den Sinn kommen. Die Stadt begeistert und zieht einen in den Bann, im nächsten Moment spuckt sie einen aber auch irgendwo wieder aus, wo man es nicht vermutet. Ceratis Musik hat etwas Vertrautes. Zumindest auf den zweiten Blick. Manchmal ist sie nicht sofort eingängig, aber wer sich auf sie einlässt, dem ist sie wie ein guter Freund, ein Leitfaden, eine Schulter, an die man sich lehnen kann. Und, sehr wichtig, sie ist fast immer tanzbar. Fünf Alben hat Cerati als Solokünstler herausgebraucht und der Nachwelt Lieder geschenkt wie Te llevo para que me lleves, Lisa (Amor Amarillo), Puente, Paseo Inmoral (Bocanada), Tu cicatriz en mi (Siempre es hoy), Crimen, Adios, Me quedo aqui (Ahí vamos) oder Déja vu, Tracción a sangre und Fuerza natural aus dem gleichnamigen letzten Album, das 2009 erschienen ist. Damals sagte Cerati zur Presse über sein neuestes Werk: "Nach diesem Album kann ich mich beruhigt ins Grab fallen lassen".
Die schönsten Worte fand Ende 2010 Luis Alberto Spinetta für ihn: Dios Guardián Cristalino de guitarras / que ahora / más tristes / penden y esperan / de tus manos la palabra / Precipitándome a lo insondable / tus caricias me despiertan a la vez / en un mundo diferente al de recién... / Tu luz es muy fuerte / es iridiscente y altamente psicodélica / Te encuentro cuando el sol abre una hendija / que genera notas sobre la pared sombreada / Y suena tu música en la pantalla / sos el ángel inquieto que sobrevuela / la ciudad de la furia / Comprendemos todo / tu voz nos advierte la verdad / Tu voz más linda que nunca Doch seine Lider wollten sich nicht mehr öffnen, seine Stimme nicht mehr erklingen. Spinetta selbst verstarb Anfang 2012, zweieinhalb Jahre früher als Cerati. Wahrscheinlich wäre es jetzt an ihm, für Spinetta noch ein paar Worte aus der Schatzkammer zu kramen. Und wenn nicht, dann spielen die beiden gemeinsam Té para Tres, das "spinettaeskeste" Lied in Ceratis Repertoire. So wie einst in jenem Sommer 2007, als ich beide gemeinsam auf der Bühne erleben durfte. Da braucht es dann auch keine Worte mehr. No hay nada mejor, que casa... Text: Andreas Dauerer Fotos: amazon.de [druckversion ed 01/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: argentinien] |
| [art_4] Panama: Falsche Fische im Gatunsee Wanderungsbewegungen im Panamakanal Der Panamakanal ist nicht nur eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt, sondern auch ein sehr artenreiches Gewässer. Bei genauerer Betrachtung ist er sogar zu artenreich: hier finden sich nicht nur einheimische Süßwasserfische, sondern auch eine ganze Reihe Arten, die dort eigentlich gar nichts verloren haben. Diana Sharp, Doktorandin am Smithsonian Tropical Researchinstitute, Isla Barro Colorado, wirft den Motor ihres kleinen Bootes an und fährt hinaus auf den Gatunsee zum Fischen. Der See ist Teil des Panamakanals und dieser für die Biologin ein ganz besonderes Gewässer. "Der Kanal ist aus mehreren Gründen ein faszinierender Arbeitsplatz: Einer dieser Gründe ist, dass es eine ganze Reihe eingeschleppter Arten aus verschiedenen Gegenden der Welt gibt. Sie alle koexistieren hier in diesem künstlichen Ökosystem", erklärt die Forscherin. "Da ist zum Beispiel der Tilapia, der eigentlich aus Ostafrika stammt und als schmackhafter Speisefisch im Kanal ausgesetzt wurde. Oder der Oscar aus Südamerika, eigentlich ein Zierfisch - irgendwer wollte wohl sein Aquarium auflösen." Am interessantesten aber ist für die Doktorandin der grüne Pfauenbarsch. Auch der stammt aus dem Amazonas und erreicht eine Körperlänge von über einem Meter. "Der Pfauenbarsch wurde für den Angelsport ausgesetzt. In den 70ern wusste man noch nicht, wie gefährlich es ist, Arten von einem Teil der Welt in einen anderen zu versetzen. Die Leute dachten einfach, es wäre toll, wenn man den hier angeln könnte." Für ihre Doktorarbeit vergleicht Diana Sharpe den Panamakanal mit einem anderen See, in dem es kaum fremden Arten gibt. Sie möchte wissen, wie sich "die Einwanderer" auf die heimischen Fischbestände auswirken. Die Unterschiede sind gewaltig. "Wir fangen hier vor allem eingeschleppte Arten. Viele der kleineren, heimischen Fische dagegen, die früher sehr häufig vorkamen, scheinen verschwunden." Eingeschleppte Arten, die das Ökosystem verändern, ist ein Thema, das dem panamaischen Umweltschützer Lider Sucre große Sorgen macht. "Von außerhalb eingeschleppte Arten sind für Panama generell ein großes Problem und das hat mit dem Kanal zu tun. Durch ihn legen bei uns Schiffe aus aller Welt an, und die bringen exotische Arten mit. Früher gab es hier schwarze Geckos mit rotem Kopf. Dann kamen weiße, asiatische Geckos ins Land, und die gibt es heute in allen Häusern Panamas. Diese neue Spezies hat den heimischen Gecko komplett verdrängt. Zudem muss man bedenken, dass der Kanal zwei völlig unterschiedliche Lebensräume miteinander verbindet: Den Pazifik und die Karibik. Glücklicherweise wurde der Kanal nicht auf Meeresniveau gebaut. Das wäre eine Katastrophe gewesen, vor allem für die Karibik, denn im Pazifik gibt es außerordentlich aggressive Arten. Wenn die plötzlich in die Karibik hätten kommen können, hätte sich das Ökosystem dort völlig verändert." Das ist nicht geschehen – die beiden Ozeane sind durch Schleusen und einen riesigen Süßwassersee, den Gatunsee, voneinander getrennt. Doch ist das für die Fische eine unüberwindbare Barriere? Diana Sharpe wirft ihr Netz aus. "Hier haben wir einen Mohara. Das ist ein Meeresfisch, der auch Brackwasser und Süßwasser toleriert. Dieser hier kommt aus dem Atlantik und muss durch die Schleusen gekommen sein. Wir finden im Gatunsee sowohl Arten aus dem Atlantik als auch aus dem Pazifik." Die 26jährige ist nicht überrascht. Sie fängt regelmäßig Meeresfische in dem Süßwassersee. Eine große Zählung im Jahr 2004 ergab, dass es über 100 Meeresfischarten in den Gatunsee geschafft haben. Welche Folgen hat das? "Wir schauen uns den Mageninhalt des Pfauenbarsches an und sehen, dass er sich stark von Meeresfischen ernährt. Das ist eine interessante Situation, denn womöglich nehmen die Meeresfische den Druck von den einheimischen Fischen. Das Zusammenspiel kann also sehr komplex sein." Ein künstliches Ökosystem also mit Fischen aus aller Welt, von denen man nicht weiß, wer wen frisst – für die Wissenschaftler ein enormes Forschungsfeld. Text: Katharina Nickoleit Weitere Informationen über die Autorin findet ihr unter: www.katharina-nickoleit.de [druckversion ed 01/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: panama] |
| [kol_1] Helden Brasiliens: Die 7:1 Gesellschaft Brasiliens Schockstarre nach dem WM-Desaster Es hätte auch 8:0 ausgehen können, doch statt den Ball in der 89. Minute leicht über den herausstürzenden Julio César zu lupfen oder nach rechts auf den mitgelaufenen und nun völlig frei stehenden André Schürrle zu passen, versucht es Mesut Özil selbst. Und verzieht. Statt Tor also Abstoß und über Marcelo gelangt der Ball direkt zu Oscar, der sich zwischen die beiden deutschen Verteidiger Mertesacker und Boateng geschlichen hatte, letzterem enteilt und Neuer chancenlos lässt. Abpfiff und Ende, 7:1.
Das „Land des Fußballs“ ist Brasilien aufgrund der aktuellen Qualität des Ballsports wohl nicht mehr, aber in einem Punkt ist und bleibt es das „País do futebol“: ein einziges Spiel hat ausgereicht, um die Stimmung im Land kippen zu lassen. Seither hört man Phrasen wie: „Auch in der Bildung und im Gesundheitswesen erleiden wir täglich ein 7:1.“ 7:1 wird auf alle möglichen Missstände angewendet, wie die lahmende Wirtschaft oder abstürzende Börsen- und Währungskurse. Natürlich sind die großen Reformen ausgeblieben, immer noch laufen die Dinge so wie vor der WM-Niederlage. Bis auf die Stimmung, die einer fortwährenden Niedergeschlagenheit gleicht, einem auf ewig sich wiederholenden 7:1. Kein Wunder, dass die Jahresrückblicke auf 2014 im Zeichen jenes unsäglichen Nachmittags in Belo Horizonte standen. Und das (Un)Wort des Jahres sei „Gol da Alemanha“, so war man sich in den sozialen Netzwerken einig.  Damit es 2015 besser läuft, zumindest im Mineirão-Stadion zu Belo Horizonte, haben die Verwalter zum Jahreswechsel den Rasen ausgetauscht. Man hätte ihn natürlich auch in kleinen Stücken verpackt an deutsche Fans verkaufen können. Doch stattdessen karrte man das Grün auf 75 Lastwägen Richtung Müllkippe. Mindestens fünf LKWs hätten ihre Fracht jedoch statt auf der Kippe an verschiedenen Straßenkreuzungen rund um das Stadion abgekippt, berichten Lokalzeitungen. – Es scheint recht schwierig zu sein, sich von den Altlasten der Vergangenheit in Würde zu verabschieden. Text + Fotos: Thomas Milz [druckversion ed 01/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: helden brasiliens]
|
|
[kol_2] Traubiges: Malva-was?
Muga Blanco Rioja 2013 Weine aus Chardonnay, Riesling oder Sauvignon Blanc hat jeder schon einmal getrunken. Die finden sich in fast jedem Restaurant und kein Weinladen kommt ohne sie aus. Aber es gibt Rebsorten, die kaum jemand in Deutschland kennt. Viura oder Malvasia zum Beispiel. Dabei werden sie in Spanien schon seit Jahrhunderten kultiviert. Gerade die Viura gehört zu den klassisch spanischen Rebsorten. Und die Bodegas Muga gehören zu den Weingütern, die traditionellerweise klassisch spanische Weine herstellen. Das Weingut selbst ist schon seit fast einem Jahrhundert eine Institution im spanischen Weinbau. Es befindet sich direkt am alten Bahnhof in Haro, dem Weinbauzentrum der Rioja. Hier kommen die technischen Errungenschaften moderner Önologie genauso zum Einsatz wie das Wissen der mehr als einhundert Jahre alten Weinbauerfahrung. Das Weingut ist eines der wenigen, das noch immer all seine Gebinde aus Holz in der hauseigenen Küferei herstellt. So findet die komplette Weinbereitung ganz traditionell in Holzfässern statt. Mit Erfolg: Viele der Muga-Weine haben Weltruf und das Weingut wird in Fachkreisen als Repräsentant spanischer Weinkultur gehandelt.  Dabei sind Muga-Weine schon für unter zehn Euro zu haben – können aber bis zu 120 Euro kosten. Eines der Flagschiffe am unteren Ende der Preisskala ist der Muga Blanco Rioja, eine Cuveé aus: Viura und Malvasia! Die Viura-Traube ist die wichtigste Rebsorte unter den Weißweinen in der Rioja. Rund 15 Prozent der Anbaufläche sind hier mit ihr bepflanzt. Meist werden leichte, erfrischende Weine aus ihr gekeltert, die jung trinkbar sind und eine angenehm präsente Säure haben. Die Rebsorte eignet sich aber ebenso zur Herstellung sehr körperreicher Weine. Malvasia wird gerade einmal auf einem Viertel Prozent der Rebfläche in der Rioja kultiviert. Diese gelb-rötliche Traube, die ursprünglich aus Griechenland stammen soll, steht für intensiven Geschmack, kräftige Säure und eine geschmeidige Konsistenz. Malvasia nimmt beim Fassausbau sehr gut das Vanillearoma des Barriques an. Gemischt mit Viura bildet diese Rebsorte die Grundlage für die großen, fassausgebauten weißen Riojas. Dabei wurden noch bis vor einigen Jahrzehnten eher schwere süße Weine aus ihr vinifiziert. Dabei sind Muga-Weine schon für unter zehn Euro zu haben – können aber bis zu 120 Euro kosten. Eines der Flagschiffe am unteren Ende der Preisskala ist der Muga Blanco Rioja, eine Cuveé aus: Viura und Malvasia! Die Viura-Traube ist die wichtigste Rebsorte unter den Weißweinen in der Rioja. Rund 15 Prozent der Anbaufläche sind hier mit ihr bepflanzt. Meist werden leichte, erfrischende Weine aus ihr gekeltert, die jung trinkbar sind und eine angenehm präsente Säure haben. Die Rebsorte eignet sich aber ebenso zur Herstellung sehr körperreicher Weine. Malvasia wird gerade einmal auf einem Viertel Prozent der Rebfläche in der Rioja kultiviert. Diese gelb-rötliche Traube, die ursprünglich aus Griechenland stammen soll, steht für intensiven Geschmack, kräftige Säure und eine geschmeidige Konsistenz. Malvasia nimmt beim Fassausbau sehr gut das Vanillearoma des Barriques an. Gemischt mit Viura bildet diese Rebsorte die Grundlage für die großen, fassausgebauten weißen Riojas. Dabei wurden noch bis vor einigen Jahrzehnten eher schwere süße Weine aus ihr vinifiziert.Der Muga Blanco Rioja 2013 steht für beides: Leichtigkeit und Körperreichtum. Die Cuveé betört schon durch ihre Farbe. In einem herrlich zarten Gelb fließt sie mit hellen Reflexen, die zwischen Grün und Silber changieren, ins Glas. Dabei offenbart sie ihr schlankes, frisches Bukett, das an Zitrusfrüchte, Blumen und Gräser erinnert. Zugleich ist dieser junge Wein am Gaumen herrlich fruchtig, aber eben zugleich opulent. Leichte Anklänge an Vanille- und Röstaromen verraten den kurzen Barrique-Ausbau in den Muga-Fässern (ungefähr ein Vierteljahr). Ein herrlicher, sehr individueller Wein, mit einem lang anhaltenden, frisch-körperreichen Nachhall. Ein Wein, der uns neben seinem fabelhaften Geschmack noch etwas vermittelt: Chardonnay und Co. sind toll – aber es wird höchste Zeit, mal etwas Neues kennenzulernen! Text: Lars Borchert Foto: Bodegas Muga Über den Autor: Lars Borchert ist Journalist und schreibt seit einigen Jahren über Weine aus Ländern und Anbauregionen, die in Deutschland weitestgehend unbekannt sind. Diese Nische würdigt er nun mit seinem Webjournal wein-vagabund.net. Auf caiman.de berichtet er jeden Monat über unbekannte Weine aus der Iberischen Halbinsel und Lateinamerika. [druckversion ed 01/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: traubiges] |
| [kol_3] Macht Laune: Mit dem Stethoskop durch Morazán Ein alter Mann, sitzend in seinem Schaukelstuhl in der Mitte eines großen Raumes, umgeben von Küchenmöbeln und diversen Haustieren. Die Schlafplätze vom Rest des Raumes durch Vorhänge abgetrennt, dem Beobachter die Sicht versperrend. Die Großmutter empfängt uns herzlich an der Tür und bittet uns hinein. Wir nehmen dankend an und sind froh, der Mittagshitze für eine Weile entkommen zu sein. Sofort wird mir ein bequemer Liegeplatz in einer der Hängematten angeboten. Erschöpft und doch mit ausgesprochen guter Laune nehme ich Platz und lasse den Raum mit dem schaukelnden Großvater auf mich wirken. Da nähert sich ein äußerst neugieriger Papagei, die Schnur der Hängematte als Brücke nutzend, bis ein lauter Ruf und die wedelnde Hand der Großmutter den Vogel zur Flucht antreiben. Meine Begleiterin, eine Ärztin, packt in aller Ruhe, sich mit dem alten Mann unterhaltend, ihr Stethoskop aus. Ein Huhn durchquert gackernd den Raum, ein kleiner Junge sitzt etwas verschüchtert auf dem Schoß seiner Mutter, mich verstohlen musternd. Ich versuche mich in einer Unterhaltung, er wird rot und wendet seinen Blick ab. Die Mutter lächelt mich an. Zum Vorschein kommt eine silbrig blitzende Zahnreihe. Wir müssen beide lachen. Meine Begleiterin untersucht den alten Mann, "bitte einmal husten". Zu hören ist ein zartes kaum hörbares "Hm", kurzes Innehalten des Schaukelvorgangs, ein schüchternes Lächeln und Fortsetzung der Schaukelei. Meine Begleiterin das Lächeln erwidernd, versucht ihn lobend zu einem wiederholten Husten zu bewegen. Der Mann, nun seine ganze Kraft sammelnd, stößt ein wirklich von Herzen kommendes "Hmm" aus, einen Tick lauter als das vorangegangene. Wieder ein schüchternes Lächeln. Plötzlich schrecke ich hoch, merke, dass der Papagei sich mir bis auf einen halben Meter genähert hat, geräuschlos. Wir mustern uns mit Respekt und, was mich betrifft, auch etwas ängstlich. Der Papagei, jetzt völlig unbeweglich, weiß, dass er beobachtet wird, sieht aus den Augenwinkeln wieder die Hand auf sich zukommen und flieht in unerreichbare Gefilde. Dritter Versuch, die Lungen abzuhören: Großvater konzentriert sich wie ein Hundertmeterläufer vor dem Start, hält mit dem Schaukeln inne, sammelt die letzten Kraftreserven, bedacht, nicht die Haltung zu verlieren, sich aufrecht hinsetzend in seinem Schaukelstuhl. Totenstille, die Spannung spürbar! Die ganze Aufmerksamkeit ruht auf dem alten Mann. Dann, zweimal hintereinander ein kurzes "Hm-hm" und Luft entweicht. Die Ärztin schnell mit ihrem Stethoskop über den Rücken des alten Mannes eilend, Töne erhaschend, hoch konzentriert. Danach auf allen Gesichtern ein Entspannungslächeln. Endlich geschafft! Dem Mann Medikamente dalassend, ziehen wir zur nächsten Hütte und weiter. So treffen wir den ganzen Tag Menschen, in ärmlichen Hütten lebend, doch immer froh ob unserer Ankunft und immer gastfreundlich. Ich, eingenommen von der Wärme der Leute und der Ungezwungenheit der Kinder. Nach einer Woche verlasse ich, beeindruckt von der Gastfreundschaft und Offenheit der Leute, Morazán in Richtung San Salvador, dankbar diese Erfahrung gemacht zu haben. Text: Birgit Schönauer [druckversion ed 01/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: macht laune] |
| [kol_4] Grenzfall: Weihnachten auf den Kanaren - moralisch verwerflich? Als Europäer, der seit der Atomkatastrophe von Fukushima mehr Stein- und Braun-Kohle verbrennt als jemals zuvor, fühlen sich viele Menschen wohler mit Urlaubsreisen, die nicht noch mehr Umweltschäden anrichten, als man ohnehin bereits im deutschen Alltag fabriziert. Gleichzeitig ist man als aufstrebender Akteur der Leistungsgesellschaft natürlich chronisch dem Burnout nahe. Das Wort "natürlich" klingt bagatellisierend, ist es aber nicht. Somit reichert man seine eigene Urlaubsplanung mit einer gesunden und wichtigen Portion Egoismus an: Das ganze Urlaubsprojekt soll einen runter fahren. Am besten nachhaltig: Wie traumatisch wäre es, Urlaub lediglich deshalb zu bestreiten, um danach wieder ein leistungsfähiger Volldepp zu sein. Nein! Der Urlaub soll dieses Mal dazu befähigen, das Hamster-Laufrad nach dem Urlaub langsamer drehen zu lassen und es in die Richtung zu steuern, die die seine ist.  Reiseplanung Bei der Auswahl des Reiseziels sind die Kanaren sehr schnell im Spiel. Meine Frau, Künstlerin und seit einigen Wochen Mutter, beschließt: "Ich will meinen Körper spüren und nicht verschissene Windeln in einem unromantischen Winter wechseln, der sich durch spritzenden Matsch am Straßenrand auszeichnet.“ Dies sagt sie in aller Bescheidenheit. Als Künstlerin ist sie chronisch pleite. Wir stellen uns moralische Fragen zur Rechtfertigung des Fluges, wo man doch mit dem Supersparpreis der Bahn auch die Winterferien in Bozen verbringen könnte: Schafft ausgerechnet unsere Reise auf die Kanaren persönliche Mehrwerte, mit der wir unseren Flug und damit den einhergehenden, miserablen CO2-Flugabdruck rechtfertigen können? Ist die Reise so geil, dass sie für unser Glück durch nichts zu ersetzen sein wird? Wäre ein Aufenthalt mit Pizza zu Hause auf dem Sofa nicht ähnlich sinnstiftend und erholsam für uns?  Wir schieben die Fragen erstmal beiseite und beruhigen uns mit dem Gedanken abgesehen vom Flug nachhaltig zu reisen. Aber was heißt "abgesehen von…“, wo der CO2-Schrott eines Fliegers durch keine Lebensführung der Welt zu kompensieren ist. Der Spruch "Das Flugzeug fliegt doch eh“ wirkt wie ein schlechter Scherz in Anbetracht der Erderwärmung und der damit verbundenen möglichen Katastrophen. Die Ausgestaltung des Feigenblattes 1. Wir kaufen den Flug im lokalen Reisebüro. Langes Suchen im Internet, um den Flug günstiger zu bekommen, lassen wir entfallen. Uns ist einfach nur wichtig, dass der Flug direkt ab unserem Heimatort erfolgt. Das Reisebüro verdient an uns drei vermutlich nicht mehr als 20 Euro. Peinlich genug, dass wir uns für diese Summe hier rühmen, nachdem es immerhin um unseren Urlaub geht. 2. Wir kompensieren den Flug bei Atmosfair. 3. Wir informieren unsere Freunde, dass unsere Wohnung für zwei Wochen leer stehen wird und wer mag, sie nutzen kann. 3. Wir drehen die Heizung ab, leeren den Kühlschrank und ziehen alle Stecker. Für potentielle Gäste hinterlassen wir Anweisungen zur zwischenzeitlichen Inbetriebnahme.  Der Urlaub beginnt per Direktflug. Vor Ort eine Ferienwohnung im Fischerdorf. Diese im Internet gebucht. Ohne langes Suchen. Ankunft bei 22 Grad. Wir wohnen also in einem Fischerdorf. Der Begriff wirkt abstrus, da keine 30 Kilometer entfernt von uns die Urlaubsbunker stehen, die die Welt nicht braucht. Nun grübeln wir, ob dieser diskriminierende Gedanke rechtens ist oder eher eine Frechheit im Zeichen von Toleranz und Völkerverständigung. Wir überlegen, ob wir wegen Pegida auch die pauschalsten Bettenburgen-Touristen mögen müssen? Der Begriff "Fischerdorf" jedoch hält, was er verspricht. Trotz der vielen Speisekarten auf Deutsch. Oder gerade deswegen. Man darf ja auch den sich anbahnenden Burnout nicht vergessen, der nach Routinen und gewohnter Umgebung schreit.  Am zweiten Tag unserer Reise treffen wir Sepp B. beim Espresso an der Plaza. Ich stelle mir die Frage, warum so ein gottverdammter Lebenskünstler, um die Uhrzeit keinen Weißwein trinkt, nach dem mir gerade ist – und beschließe, in Zukunft nur noch eine bestimmte Dosis Entspannungsgetränke zu mir zu nehmen. Am vierten Tag treffen wir Mirco. Er leiht uns sein Surfboard. Ein Auswanderer in der zweiten Generation mit dem Ziel, Touristen eine tolle Zeit zu bescheren. Er sagt, weil "ihm das was bringe". Wir fühlen uns zunächst wie bei einem von uns vor Jahrzehnten geführten Verkaufsgespräch über eine handgeschnitzte Figur am Strand in Senegal. Es geht nicht um Aufdringlichkeit, sondern das Gefühl, dass man sich als Tourist auch immer ein wenig als Opfer fühlt. Wir rufen Mirco an: Gib uns den Wellenreitkurs! Keine Stunde später ist er da, mit seiner Frau, die während des Wassersports auf unseren Nachwuchs aufpasst. Wir lernen, dass man die Welle dann verlässt, wenn Sie am höchsten ist. Nachdem Mirco uns für viel zu wenig Geld in die Wellen entführt hat, erzählt er uns beim anschließenden Abendessen, dass er ausschließlich von eigenem Photovoltaik-Strom lebt. Verdammt! Schon wieder Impulse! Und auch noch so politisch Korrekte! Aber das Burnout wird auf einmal von der Inspiration überwältigt, unterstützt von Calamares und Boquerones.  Nach der Urlaubsreise am zweiten Weihnachtsfeiertag liegen wir, zurück in der Heimat, auf dem Sofa und sehen eine Sendung über Dankbarkeit im Sonntags-TV. Uns wird erklärt, dass Dankbarsein nicht nur per se gut sei, sondern vor allem der eigenen Psyche gut tue. Erst jetzt wird der tiefere Sinn unserer Reise greifbar. Wir sind dankbar, zwei Menschen getroffen haben, die uns nicht nur das Surfen beigebracht haben, sondern auch die Gewissheit, dass sie sich bemühen ein menschenfreundliches Klima zu erhalten. Zuhause hätte ich mir diese Gedanken nie angehört und bin neidisch auf alle, die diese Erkenntnis ohne Kerosin erlangen: Ich hätte es nicht geschafft. Nachhaltige Entwicklung ist vor allem eine Kunst der Reduktion. Die Königsklasse. Die Reise hat uns die Impulse gegeben, zu reduzieren. Das nächste Mal fahren wir nach Lanzarote, mindestens für zwei Monate, und überdenken das Transportmittel. Text + Fotos: Boquer Ones Julia und Mirco: www.lanzarote-individual.com Lanzarote ist ein Traum für kleinere Wanderungen, Wellenreiten, Baden, Tauchen und Klettern. Und das alles in gemütlichen Tempo bei Vino Tinto und frischen Meeresfrüchten. Der Aufenthalt wird um so entspannter, je mehr Vertrauen man in die Menschen vor Ort setzt. Schönste Anreise nach Lanzarote: Mit dem Zug nach Portimão (Portugal). Mit der Fährlinie Armas kann man in bequemen Kabinen oder auf schlichtem Sitzplatz übersetzen. Anfahrten mit der Fähre sind auch von Cádiz (Transmediteranea) und Huelva (Armas) in Spanien möglich. [druckversion ed 01/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: grenzfall]
|
.