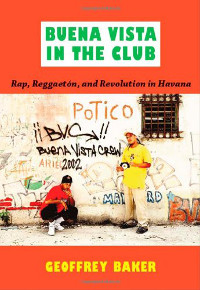[art_4]
Peru: Lima – 2150, ungefähr

Meine Rettung war meine dunkle Hautfarbe und eine seltsame Frau mit Namen Erika. Ohne sie hätte ich diese Reise wohl kaum überlebt. Dabei hatte alles so angenehm angefangen. Eines Morgens kam die Chefin in meine Zelle und sagte zu mir: "Clark, ich bin sehr zufrieden mit Ihnen! Sie haben sich einen Urlaub verdient. Die nächsten zehn Tage will ich Sie hier nicht sehen. Spannen Sie mal richtig aus, machen Sie einen Kurztrip oder was immer Ihnen Spaß bereitet."
In dem Reisebüro an der Ecke gab es ein Sonderangebot: 10 Tage alte Kulturen Amerikas. Peru und die Inkas. Nun ist Peru, wie der Rest der Länder südlich der Grenze USA-Mexiko, Touristensperrgebiet. Seit der letzten, der Großen Weltwirtschaftsreform, in der vom Traum einer gesamtheitlich zivilisierten Welt endlich Abschied genommen wurde und in der im wesentlichen beschlossen wurde, die ärmsten Länder sich selbst zu überlassen, ist Südamerika sowie weite Teile Asiens für den Besuch gesperrt. Aber mein Reiseagent hatte ein Programm aufgetan, das echtes Abenteuer versprach: eine sichere Sache, aber mit dem Geruch nach ein bisschen Gefahr.
Alles begann wie versprochen. Von Washington aus nahm die Reisegruppe einen Spezialjet, der nach allzu langweiligen zwei Stunden auf dem Spezialflughafen in Lima landete. Ein bisschen störte die Präsenz der Rednecks, aber es war ja nur zu unserem Schutz. Einreiseformalitäten waren erfreulicherweise nicht mehr nötig, seit die USA die Nationalrechte Perus aberkannt hatte. So konnten wir ungestört vom Jet aus in unser Glasmobil steigen, das uns eine perfekte Sicht unter Panzerglas erlaubte. Die Agentur hatte mir versichert, dass das Glas unzerstörbar wäre. Nicht dass die Peruaner noch Waffen hätten, erläuterte schmunzelnd der Verkäufer, das haben wir schon vor einiger Zeit erledigt, aber man weiß ja nie. Und wir wollen schließlich nicht, dass unseren Kunden etwas passiert!
Trotzdem war es ein mulmiges Gefühl, als wir auf die ersten Eingeborenen stießen. Sie waren schrecklich schmutzig und dürr. Ein paar warfen sich vor unser Mobil, aber die eingebauten Wasserwerfer wurden leicht mit ihnen fertig. Die Hauswände waren beschmiert mit hässlichen Sprüchen, in deren Mehrheit das Wort ‚Amerika’ und irgendein Schimpfwort vorkamen. Ich hörte meine Nachbarin sagen: "Ich wusste gar nicht, dass die hier auch schreiben können!" Tatsächlich war auch ich überrascht, hatte ich doch noch in den Ohren, wie meine Erdkundelehrerin uns die Grenzen der zivilisierten Welt erklärte und was dahinter lag. Der Transfer zum Hotel außerhalb der hässlichen und heruntergekommenen Stadt Lima verlief reibungslos, auch wenn uns allen ein bisschen die Haare zu Berge standen, wenn wir die brennenden Müllhaufen und die darum gescharten Leute sahen. Mehr als einmal hörte ich erschrockene Ausrufe. Unsere Multimediakameras surrten ohne Ende.
Das Hotel war erstklassig, ebenso wie der Empfang. Das Gelände war bestens gegen Peruaner abgeschirmt, erklärte uns der Führer, der uns die nächsten zehn Tage begleiten sollte; dachten wir jedenfalls. Er versicherte uns, dass kein Mensch in der Lage wäre, lebendig die Mauern des Hotels zu übersteigen und noch viel weniger den Gürtel der intelligenten Minen zu durchqueren. Wir könnten beruhigt schlafen. No problem. Er schärfte uns allerdings ein, die Sicherheitszone des Hotels nicht zu verlassen, da die Minen, fügte er achselzuckend hinzu, leider immer noch nicht zwischen einem Amerikaner und einem Peruaner unterscheiden könnten. Obwohl sie intelligent hießen. Vereinzeltes Gelächter der Gruppe. Ich unterhielt mich mittlerweile mit einer hübschen Blondine aus Oregon, einer Spezialistin in Geruchsdesign. Ich ließ mir erklären, was genau das sei, ohne eigentlich Interesse daran zu haben. Der Führer sprach indes weiter über die große Zeit der Inkakulturen; er erwähnte auch, dass die wichtigen Ruinen geräumt worden waren, kurz nach der Weltwirtschaftsreform, um das kulturelle Erbe zu sichern. Peruaner waren seitdem in einer Sicherheitszone von fünf Kilometern rund um die Ruinen nicht zugelassen. Einige Dörfer hatten geräumt werden müssen, aber dafür, so der Führer, sei der Zerstörung der Ruinen Einhalt geboten worden. Teams von amerikanischen Spezialisten arbeiteten seitdem konstant an der Rekonstruktion der originalen Städte und Siedlungen, und auf unserer Reise würden wir Gelegenheit haben, einige echte Inkastädte zu besuchen. Mit Originalinkas (Schauspieler, natürlich), die uns in ihre Zeit zurückholen würden. Immerhin über 600 Jahre her. Wir würden Gelegenheit haben zu erleben, wie der Inka und seine Ñusta in Cuzco gelebt haben. Die koloniale Stadt war in den 30ern dieses Jahrhunderts geschleift worden, um der alten Pracht wieder ihre Geltung zu verschaffen. Dort würden wir auch die prachtvolle Krönungszeremonie erleben und einem Menschenopfer beiwohnen. Letzteres sei natürlich gestellt, fügte der Führer lüstern grinsend hinzu. Mehr wolle er uns heute nicht verraten, denn erstens warte das Essen und zweitens sei Spannung doch die halbe Miete. Verhaltenes Klatschen der Reisenden.
Das Essen war erstaunlich normal. Die Hamburger in Peru schmecken fast so wie bei uns, obwohl sie anders heißen. Ich konnte mir den komplizierten Namen nicht merken. Einige von uns fragten den Führer, ob das Essen auch sicher sei und ob es denn nichts von zu Hause gäbe. Er versicherte, dass die Lebensmittel einer ständigen Kontrolle unterliegen und so wenig wie irgend möglich mit Eingeborenen in Kontakt kämen. Und dass die Herrschaften ruhig mal die Reise auch durch den Gaumen genießen sollten. Das Bier war kalt; meine Nachbarin leider auch. Ich kam an diesem Abend keinen Schritt weiter. Vielleicht hatte sie gemerkt, dass mich das Thema Geruchsdesign nur nebensächlich interessierte.
Am nächsten Morgen ärgerte ich mich mit der Dusche herum, weil sie gerade mal 38°C heißes Wasser produzierte. Ich hasse das! Mein Wasser muss morgens mindestens 42°C haben, damit ich in Schwung komme. Ich rief bei der Rezeption an, aber sie waren nicht in der Lage, mein Problem zu beheben. Wahrscheinlich wird man so, wenn man hier länger ist: ein bisschen langsam im Service.
Nach dem Frühstück (die Blonde hatte sich ostentativ an einen anderen Tisch gesetzt) ging es dann los in unserem Glasmobil. Und was wir dort aus unseren Fenstern sehen konnten, war schon eine Reise wert. Nach der Reform, als Amerika endgültig und offiziell zur weltweit herrschenden Nation erklärt wurde, haben wir die Agrikultur in die halbgesicherten Gebiete rund um Europa verlegt. Das war ein ökonomisch sehr sinnvoller Schritt, denn unsere eigenen Bauern waren viel zu teuer geworden. Und der Boden viel zu kostbar, um darauf Kartoffeln anzubauen. Bei einer stetigen Wachstumsrate der Bevölkerung von 10%, wo sollten wir mit den ganzen Leuten hin? Und in den halbgesicherten Zonen waren sie auch glücklich, denn so hatten sie einen riesigen Absatzmarkt. Außerdem wurden Gemüse und Fleisch so billig, dass unser Armutsproblem, das wir noch fast bis Mitte letzten Jahrhunderts hatten, gelöst wurde.
Aber es war schon interessant, Landwirtschaft einmal mit eigenen Augen zu sehen. Ochsen kannte ich ja noch aus dem Zoo, aber einen Pflug nur noch aus dem Geschichtsbuch. Wir sahen auch Leute auf Eseln reiten, den Boden hacken, Mangos ernten. Der Führer erklärte uns alles, während wir an den Feldern lautlos entlang fuhren. Die Leute sahen von ihrer Arbeit auf und ihre Augen waren leer. Irgendwie so unmenschlich leer. Ich versuchte, mit meiner Banknachbarin ein Gespräch darüber zu führen, aber sie konnte für die Menschen kein Interesse aufbringen. Das einzige, was sie faszinierte, waren Esel, Maultiere und Hunde in freier Wildbahn.
In Cuzco verbrachten wir zwei ganze Tage. Sehr interessant, muss ich sagen. Wir wurden vom Inka persönlich begrüßt. Ein sehr zivilisierter Mensch, der übrigens auch ein ausgezeichnetes Englisch sprach. Seine Frau, die sich Ñusta nennen ließ, war sehr hübsch, aber nur wenig gesprächig. Die Stadt bestand aus beeindruckenden Bauten. Ich wollte zwar nicht glauben, dass die fein geschliffenen Steine, die fugenlos aneinandergefügt waren, ohne Hilfe eines Lasers hergestellt worden waren, aber abgesehen davon, war die Szenerie phantastisch ebenso wie die Krönungszeremonie. Der Mantel aus Papageienfedern, den der Inka trug und die Brustplatten aus echtem Gold. Prachtvoll!
Etwas allerdings empörte uns alle: bei dem Festmahl nach der Krönung wollte man uns doch glatt im Ofen gebratenes Meerschweinchen vorsetzen! Sie nannten das cuy und eine Spezialität der Inkas. Unter der Gruppe brach helle Empörung aus. Ein Professor für Anthropologie, der mit seiner Gattin diese Reise wohl aus wissenschaftlichem Interesse unternommen hatte, wies entrüstet darauf hin, dass man schließlich heute auch keinen Dreck mehr fräße wie die frühen Menschenkulturen. Der Protest der gesamten Gruppe führte schließlich dazu, dass die Reiseleitung die Teller mit den abscheulichen Tierchen wieder abräumte und uns echte peruanische Spaghetti servieren ließ. Die waren in Ordnung, obwohl ich eine Menge Ketchup darauf geben musste.
Wir kamen erst spät ins Bett, weil das Menschenopfer, das wir nach dem Abendessen sehen sollten, sich aus irgendeinem Grunde verzögerte. So ist das eben auf Abenteuerreisen, versuchte ich mich bei der Eselsliebhaberin, da ist nicht alles so perfekt wie sonst. Im Bett versuchte ich sie mit Meerschweinchenpiepen aufzulockern, aber das fand sie gar nicht komisch.
Am zweiten Tag fuhren wir nach Macchu Pichu. Dort erwartete uns die Ñusta, denn – so wurde uns erklärt – Macchu Pichu galt als die geheime Stadt der Frauen. Die Umgebung war beeindruckend. In einem kleinen Tal inmitten der Anden gelegen, von schneebedeckten Gipfeln umringt. Das Sauerstoffgerät störte ein bisschen, aber man hatte uns erklärt, dass man sich – nicht wie in Cuzco – dazu entschlossen hatte, keine Glaskuppel über die Stadt zu bauen, da die Sonnenauf- und -untergänge sonst in ihrer Pracht beeinträchtigt worden wären. Und tatsächlich war der Sonnenuntergang, den wir – begleitet von einigen Initiationsriten der jungen Frauen des Inka – sahen, sehr bemerkenswert. Die Frauen kreischten ein bisschen bei der expliziten Darstellung, aber ich beruhigte meine Eselsliebhaberin und Meerschweingeräuschhasserin damit, dass das ja alles Vergangenheit war und nur noch für uns Touristen gemachte wurde. Und dass sie froh sein solle, nicht hier geboren zu sein.
Ich weiß nicht, woher zum Teufel sie Dynamit gehabt haben könnten. Es ist mir unbegreiflich, denn schließlich liegt schon seit über hundert Jahren ein Waffenembargo auf dem gesamten südlichen Kontinent. Aber sie hatten es irgendwoher und sie haben es benutzt. Ich hatte zu Hause noch etwas von den terroristischen Banden in Peru gehört, ich weiß nicht mehr von wem. Aber von Übergriffen auf Reisegruppen? Das war unerhört. Natürlich hatten wir bewaffnete Begleitung für den Fall der Fälle, aber niemand konnte mit einem Attentat rechnen. Vielleicht hätte der Fahrer schneller schalten müssen, als er das fremde Auto auf der amerikanischen Straße sah. Wie auch immer.
Wir waren die Nacht über gefahren: direkt von Macchu Pichu zurück nach Lima, denn dort stand das einzige annehmbare Hotel. Über die Herberge in Cuzco habe ich bisher geschwiegen, aber nur weil das Teil der Abmachung mit meinem Reisebüro ist. Schließlich haben sie teuer dafür bezahlt.
Es passierte kurz nachdem wir in Lima eingefahren waren. Wir hatten auf dem Weg einige Protestler gesehen, die uns wütend anschrieen. Ihre Ähnlichkeit mit Affen ließ mich über die Gegner der Theorie Darwins nachdenken. Immerhin die Hälfte der Amerikaner, hatte ich neulich gelesen, glauben nicht an die Theorie der Evolution. Dabei reichte doch eine einzige Reise nach Peru, um das mehr als offensichtlich zu machen. Der missing link, dachte ich lächelnd, als ich ein schönes und wahrscheinlich besonders laut brüllendes Exemplar ausmachte.
Der Kleinlaster kam von links. Ich hatte ihn nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen und in dem Bruchteil des Augenblicks bis zur Explosion blieb nicht genügend Zeit, um mich darüber zu wundern, dass auf einer kreuzungslosen Straße ein Auto von links kommen kann.
Über die nächsten paar Stunden kann ich kaum Auskunft geben. Es gab einen fürchterlichen Krach, etwas fiel mir auf den Kopf, ich flog in hohem Bogen durch die Gegend und danach weiß ich gar nichts mehr. Als ich erwachte, war es dunkel, und ich lag verborgen hinter einem verbeulten Stück Metall, das mir die Sicht nahm. Und wohl auch den Terroristen die Sicht genommen hatte, denn ich war bis auf ein paar Beulen unverletzt geblieben. Als ich vorsichtig hinter dem Stück Metall hervorblickte, sah ich auf ein brennendes Feuer und eine Menschenmenge. Ich sah auch einige von unserer Reisegruppe gefesselt am Boden sitzen. Später sind alle freigekommen, gegen ein saftiges Lösegeld, versteht sich, aber das konnte ich in diesem Moment nicht wissen.
Um die Wahrheit zu sagen, mir sank das Herz in die Hose. Die Gruppe, die um meine Mitreisenden herumstand, sprach eine unverständliche Sprache, nur entfernt mit unserem Spanisch verwandt. Sie sahen furchterregend aus. Ich entdeckte weder den Fahrer, noch den Führer, noch unsere bewaffneten Begleiter. Ich hörte eine helle Stimme kreischen: "Meinen Ehering nicht", und dann eine saftige Ohrfeige klatschen. Leises Weinen.
Ich musste einen Weg finden, von hier zu verschwinden. Jeden Augenblick konnten sie mich entdecken, und dann würde es mir nicht besser ergehen als der armen Gruppe. Gott sei Dank lag die Stadt fast völlig im Dunkeln. Außer dem Feuer ein paar Schritte von mir entfernt, konnte ich in der Ferne einige Lichtpunkte sehen, die sicherlich von ähnlichen Lichtquellen stammten. Der Rest aber lag in schwarzer Nacht.
Die größte Gefahr war jetzt, von dem nahen Feuer beleuchtet zu werden, während ich davon robbte. Ich warf mir einen alten und stinkigen Fetzen über, der weiß der Himmel woher kam und kroch los. Ich wusste zwar nicht wohin, aber das war im Moment zweitrangig. Erst mal weg und dann weitersehen. Die einzigen beiden Punkte der Stadt, an denen ich sicher sein würde, waren das Hotel und der Flughafen. Aber wie dort hinkommen?
Das Glück ist mit den Tüchtigen, sagt man. Und ich hatte in dieser Nacht gleich mehrfach Glück. Zuerst ließ mich das Schicksal dem Feuer entkommen. Ich war noch dazu in die richtige Richtung gerobbt, denn bald entdeckte ich die Bresche in der hohen, weißen Mauer, die die amerikanische Straße von dem Rest Limas abschotten sollte. Und die kein echtes Hindernis darstellte.
Ich hielt mich im Schatten der Mauer auf der anderen Seite und fürchtete nichts mehr, als irgendjemandem zu begegnen. Und dabei sollte die Begegnung, die sich jetzt gleich ereignen würde, mir das Leben retten.
Ich hielt den stinkigen Lappen fest um mich gewickelt, aber sowohl die Beine als auch vor allem meine neuen Nikes, die ich extra für die Reise gekauft hatte, würden mich sofort an die Eingeborenen verraten. Meine Tarnung war also alles andere als perfekt, aber ich musste es versuchen. Ich dachte angestrengt darüber nach, wie ich wohl zum Hotel finden sollte, als ich an der gegenüberliegenden Hauswand einen Schatten ausmachte, der sich in meine Richtung bewegte. Sofort verharrte ich in meiner Bewegung, versuchte die alte Taktik, die man mir für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich jemals einer Schlange begegnen sollte, beigebracht hatte: nicht bewegen. Keinen Muskel.
Leider war der Schatten nicht der einer Schlange: sie war schneller über mir, als ich auch nur mit dem Lid hätte zucken können. Und bevor ich Cheesecake sagen konnte, hatte ich ein Messer an meiner Kehle. "Lauf oder stirb!", sagte eine weibliche Stimme in verständlichem Spanisch. Ich versuchte es mit einem: "Ok."
Sie sprang einen halben Schritt von mir weg, das Messer immer noch auf mich gerichtet: "Wer oder was bist Du?", fragte sie in noch verständlicherem Englisch. Ich war meinerseits überrascht, schaltete aber schnell: dies war meine Chance, wenn ich denn eine hätte. "Ich bin ein amerikanischer Tourist. Unser Glasmobil ist von Terroristen überfallen worden, und ich bin der einzige, der entkommen ist. Bitte lass mich gehen!"
Sie schaute mich zweifelnd an, aber das Messer sank um einige Zentimeter nach unten. "Ja, ich habe von dem Überfall gehört", sagte sie mich nachdenklich anblickend. "Lima ist eine sehr gefährliche Stadt. Wo willst du hin?", fügte sie nach einem Moment des Schweigens hinzu. Ich hatte in der Zwischenzeit in Gedanken schon meine Dollar gezählt, denn ich war davon überzeugt, meine Freiheit mit ein paar Scheinen erkaufen zu können. Aber sie erwähnte das Geld nicht einmal. "Alleine überlebst du keine zehn Minuten auf den Straßen hier. Ich wohne nicht weit weg. Komm erst mal mit, dann sehen wir weiter."
Ich wusste nicht recht, was ich machen sollte. Mit einer Eingeborenen nach Hause gehen? Andererseits hatte sie vermutlich recht, ich würde keine Chance haben auf den Straßen Limas. Und wenn sie mir eine Falle stellen wollte, um mich umzubringen, dann hätte sie einfach nur zustechen müssen, als sich ihr Messer noch an meiner Kehle befand. Ich nickte. Sie warf mir ihren Poncho über und hieß mich, hinter ihr zu laufen und um keinen Preis den Mund aufzumachen, geschehe, was geschehe.
Doch auf dem Weg zu ihr begegneten wir niemandem. Ein oder zweimal hatte ich den Eindruck, dass wir beobachtet würden, aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Bei ihr zuhause erfuhr ich, dass sie Erika hieß und dass sie kein Telefon besaß. Sie lachte laut, als ich sie fragte. "Mein Urgroßvater hatte noch eines, erzählte mir mein Vater immer, wenn er melancholischer Stimmung war." Ich fragte nicht, was mit ihrem Vater geschehen war. Sie hatte die Fensterläden geschlossen, bevor sie die Öllampen angezündet hatte, die ein eigenartig flackerndes Licht auf die Wände warfen. Ich blickte mich um, aber in Wirklichkeit war nicht viel zu sehen außer den Rissen im Gemäuer. Ein hölzerner Hocker und ein wackelnder Stuhl standen um einen alten Tisch herum. Die Tischdecke war grau vom vielen Waschen. In einem kurzen Moment der Entspannung vermisste ich meine Kamera: das wäre ein explosives Material zu Hause! Ein echtes Haus einer Eingeborenen! National Geographic würde gutes Geld dafür zahlen. Dann stürzte die Wirklichkeit wieder auf mich ein. "Hör zu, ich muss zu dem amerikanischen Hotel oder zum Flughafen für Touristen", sagte ich. Erika blickte mich an. "Das ist sehr gefährlich. Vielleicht sogar unmöglich. Man kommt von außen nicht einmal in die Nähe."
"Egal, irgendwie muss ich dahin. Oder an ein Telefon." Ich konnte immer noch nicht glauben, dass es hier kein Telefon geben sollte. Vielleicht hatte sie keines, aber die Geschichte von ihrem Urgroßvater konnte ich ihr unmöglich abnehmen. Jeder Mensch hat Telefon.
"Es ist sehr gefährlich", wiederholte sie nachdenklich, "und alleine schaffst du das niemals. Hier in Lima ist es selbst für einen von uns schwer zu überleben. An der nächsten Ecke nehmen sie dich hoch, wenn sie merken, dass du ein Gringo bist." "Dann hilf mir. Bitte!", fügte ich hinzu. "Warum sollte ich meine Haut für dich riskieren?" Ich überlegte, ob ich das Thema Dollars riskieren sollte. Sicherlich würde sie alles für ein paar Scheine, vielleicht sogar für ein paar Münzen machen. Aber bevor ich etwas sagen konnte, sprach sie schon weiter.
"Ich werde dir helfen. Du musst wissen, dass nicht nur du, sondern auch ich mein Leben dabei riskiere. Und dass ich nicht weiß, ob wir es schaffen können. Ich kann dich nur bis zum Rande der Touristensperrzone bringen. Danach musst du selber einen Weg hineinfinden. Mich würden sie sofort erschießen, wenn ich versuchen würde, dort einzudringen. Und jetzt, nach dem Überfall noch eher."
"Aber das hat seinen Preis." Sie blickte mich einen Moment aus ihren tiefbraunen Augen an. "Du musst mir ein Visum verschaffen. Du musst allen erzählen, dass ich es war, die dich hier herausgebracht hat. Dass ich dich gerettet habe und dass ich Englisch spreche. Dass ich Zahnärztin bin und dass ich in Amerika leben will. Du musst alles daran setzen, dass ich ein Visum bekomme, versprichst du mir das?" Ich versprach es ihr natürlich. Das und noch viel mehr hätte ich ihr versprochen. Einen Haufen Gold, ein Königreich, wenn es sie gefreut hätte. Was hatte ich zu verlieren? "Ich muss dir vertrauen, so wie du mir vertrauen musst." Sie dachte einen Moment lang nach: "Kann ich dir vertrauen?"
Ich versicherte, alles Menschenmögliche zu unternehmen, damit sie ihr Visum bekäme. Ich gab vor, Freunde bei der Einwanderungsbehörde zu besitzen, darauf zählend, dass sie nicht wusste, dass die Einwanderungsbehörde schon in meiner Jugend aus dem einfachen Grund abgeschafft worden war, weil es keine Einwanderung mehr gab. Sie schluckte es nicht nur, sondern freute sich sogar sichtlich. Ich gab vor, dass ich kein Problem mit ihrer Einreise sähe, wenn ich erst mal zurück zu Hause wäre und die Geschichte dort erzählen könnte.
Wir brachen noch in derselben Nacht auf. Ein unidentifizierbares Getränk, das sie irreführenderweise Kaffee nannte, lehnte ich dankend ab. Sie wirkte angespannt, aber zufrieden mit mir, und ich tat alles, um diesen Eindruck zu verstärken. Sie bat mich, ihr von Amerika zu erzählen, aber ich wusste nicht recht, was ich ihr erzählen sollte. Ich war noch nie jemandem begegnet, der nicht alle Folgen von „Fünf Teufel und George“ mindestens dreimal gesehen hatte: was erzählt man da? Sie hatte damit kein Problem: das sollte ich bald merken.
In ihrem Schrank suchte sie eine unauffällige (will sagen: dreckige, verschlissene und abgrundhässliche) Jacke heraus, die ich anziehen sollte. Die Hosen, die sie mir gab, waren genauso „unauffällig“ und dazu noch zu klein. Sie gab mir einen Strick aus irgendeinem Naturmaterial: den sollte ich als Gürtel benutzen. Alleine meine Schuhe waren ein Problem. Die neonfarbigen Nikes würden sicherlich sofort auffallen und zu einer gründlichen Untersuchung, mit einiger Wahrscheinlichkeit unter Zuhilfenahme eines Messers, einladen. Nach reiflicher Überlegung schlug sie mir vor, barfuss zu gehen. Ich lehnte natürlich ab: das würde meine Socken kaputt machen. Sie erklärte mir, dass sie „mit nackten Füßen“ gemeint hatte. Ich war entsetzt. Sie hieß mich die Schuhe und Strümpfe ausziehen, und als sie meine Füße sah, lachte sie laut. "Nein, das wird auch nichts: deine Füße leuchten ja noch heller als deine Schuhe!"
Zuletzt packte sie meine Schuhe in ein paar alte Lumpen, schnürte diese oben an meinem Knöchel zusammen, und wir waren beide zufrieden. "Kein Wort, unter keinen Umständen! Gut, dass dein Gesicht nicht so weiß wie deine Füße ist. Zieh dir diesen Chullo über, das wird deine Züge ein wenig verstecken." Sie reichte mir eine bunte Mütze, die oben spitz zulief und an den Seiten noch zwei hässliche Ohrklappen aufwies. Aber meine Widerstandskraft war längst gebrochen.
Als ich mich im Spiegel anschaute, erschrak ich zutiefst: ich sah wirklich fast aus wie einer von ihnen: genauso heruntergekommen, genauso dreckig, genauso hässlich angezogen. Die Präsenz meiner Schuhe unter den Lumpen beruhigte mich ungemein: wenigstens wusste ich so, dass ich anders war. Ich hebe dieses Paar Schuhe auch heute noch liebevoll auf, obwohl sie völlig aus der Mode geraten sind, und meine Kinder immer über mich lachen. Doch dieses Paar Nikes hat mich in jener dunklen Nacht Mensch sein lassen und anders als die, die da auf der Straße herumlungerten.
"Wenn uns jemand anhält, siehst du zu, dass kein Licht auf dich fällt. Ich werde sagen, dass du ein Freund aus der Sierra bist und dass Du nicht sprechen kannst. Die Leute aus der Sierra haben hier zwar keinen guten Ruf, aber man ist bereit zu glauben, dass sie ein bisschen komisch sind und dass sie nicht reden. Sowieso kein Spanisch. In den Bergen spricht man eine eigene Sprache, wusstest du das?" Ich nickte nur, um das Gespräch abzukürzen. Was interessierte mich die Sprache des Hochlandes?
Die ersten paar Straßen lief alles gut. Wir begegneten keinem Menschen, und ich war froh drum. Erika hatte mir für den Notfall noch ein Messer in die Hand gedrückt, und das hielt ich fest von meiner Faust umschlossen in der Tasche. Sie hatte mir gesagt, dass ich es nur im äußersten Notfall ziehen sollte, denn mit großer Sicherheit würde mein Gegenüber besser damit umzugehen wissen, aber ich war entschlossen, dem ersten, der mich genauer angucken würde, den Stahl so tief in die Brust zu rammen, wie ich nur irgendwie konnte.
Wir bewegten uns langsam aber stetig die Straßen entlang. Erika hatte sich bei mir eingehakt, weil das – wie sie sagte – am unauffälligsten wäre. Ich war überrascht, dass sie keinen unangenehmen Geruch ausströmte: ich hatte mir die Leute, an denen wir vorbeigefahren waren, immer von einer Art unangenehmen Geruchshülle umgeben vorgestellt.
Der Gebrauch von Englisch auf der Straße war auch zu gefährlich. Sie sprach leise in Spanisch auf mich ein, und zu meiner Verwunderung verstand ich viel mehr, als ich gedacht hätte. Und als mir lieb war. Denn Erika wurde nicht müde, mir von dem einzigen zu erzählen, was ich am liebsten ganz schnell vergessen wollte: von ihrem Land.
"Es begann alles mit dem Krieg gegen Afghanistan oder wenn du willst mit den Attentaten auf die Zwillingstürme in New York. Der Krieg, der sich bald ausweitete, brachte kaum die erwarteten Resultate. Das bestärkte die Stimmen, die schon seit langem gesagt hatten, dass man diese armen Staaten einfach aushungern sollte. Und aus diesem Gedanken erwachte mit Hilfe einiger neuer technologischer Entwicklungen eine neue politische Strömung, die erst die Vereinigten Staaten, dann aber auch Australien und Japan ergriff: die Lösung der Weltprobleme war endlich da! Sie war so simpel wie genial: man koppelt einfach zwei Drittel der Weltbevölkerung ab und überlässt sie sich selbst. Keine Spendenaktionen mehr, keine Bilder hungernder Kinder, keine Alphabetisierungskampagnen. Keine Umschuldung mehr, keine Kredite von der Weltbank. Die unterentwickelte Welt wurde geschlossen. In Peru haben wir länger als andere ausgehalten. Zu dem Zeitpunkt im Jahre 2030, als die Große Weltwirtschaftsreform durchgeführt wurde, ging es Peru gar nicht so schlecht. Wir hatten seit 2001 eine konstante demokratische Regierung, die Maßnahmen zur Bildung der Landbevölkerung waren in vollem Gange und die Rate derjenigen, die unter einem Dollar pro Tag verdienten, nahm ständig ab."
"Unsere Regierung hat volle fünf Jahre ausgehalten: ich weiß nicht, wie. Erst als Banditenhorden ganze Städte überfielen, gaben sie auf. Geld wurde nicht mehr gedruckt, und wir kehrten zur uralten Tauschwirtschaft zurück: ich gebe dir eine Rinderhälfte, du gibst mir einen Zentner Kartoffeln."
Erika erzählte ihre Geschichte so leicht und ohne jeglichen Vorwurf, dass es mir leicht fiel, nicht hinzuhören. Ich war ganz auf das Geschehen auf der Straße konzentriert. Keine Menschenseele war dort zu sehen, nur vereinzelt flackerte in der Ferne, zu sehen durch eine der leeren Straßenschluchten, ein Feuerschein. Sie sprach indes scheinbar unbeschwert weiter.
"Das System funktioniert aber nur solange, wie jeder etwas beisteuern kann, was direkt verwertbar ist. Aber nachdem wir keinen Import mehr hatten und damit zum Beispiel kein Benzin und dadurch wiederum die Autos überflüssig wurden, was sollte ein Automechaniker, ein Busfahrer da tauschen? Der Hunger war der Ursprung der bewaffneten Banden."
"Obwohl eigentlich die ersten, die die Folgen der Großen Wirtschaftsreform zu spüren bekamen, die Kinder waren. Die Schulen wurden geschlossen, denn die Lehrer mussten sich etwas suchen, was ihren knurrenden Magen beruhigte. Die werdenden Mütter wurden immer dürrer, von den Neugeborenen starb bald ein Drittel: schlimmer als zu Zeiten der Inka, sagt man. Bald breiteten sich Seuchen aus, denn der Müll wurde nicht mehr abgeholt."
"Es gab einige Initiativen, die öffentliche Ordnung trotz allem aufrecht zu erhalten. In Ayacucho, in der Sierra, gab es eine Organisation von Freiwilligen, die sich Esperanza nannte und versuchte, die grundlegenden Dienste auf freiwilliger Basis aufrecht zu erhalten. Sie erinnerten sich an die alten Traditionen aus den Zeiten, bevor die Spanier kamen. Die Angehörigen dieser Organisation betrachteten sich als Ayllu, als Gemeinschaft, und verrichteten neben ihrer normalen Arbeit gemeinsame Aufgaben."
"Die bewaffneten Banden waren es, die diese kleinen Versuche, trotz allem zu überleben, zerstörten. Einige Zeit kehrte Peru zur Leibeigenschaft zurück: Banditen kamen erst in die Dörfer, später sogar in die Städte und holten sich, was sie brauchten. Arbeiter, die ihre Felder bestellen, Frauen für ihre Küchen und Betten. Und das Schlimmste ist, dass die Leute sich daran gewöhnt haben. Immerhin, sagen sie, haben wir hier zu essen und müssen nicht hungern."
Ich hatte eine Bewegung am Ende der Straße gesehen und drückte Erikas Arm. Sie schaute überrascht zu mir, und einen Moment hatte ich den Eindruck, sie dächte, ich hätte ihr von ihrer Geschichte, der ich nur mit halbem Ohr zugehört hatte, bewegt den Arm gedrückt. Mein ängstlicher Gesichtsausdruck aber belehrte sie eines Besseren. Als sie die Schatten entdeckte, spannte sich ihr ganzer Körper an. Ich hätte mich gerne in eine Ecke verdrückt, aber es gab keine. Unerreichbar weit, 30 Meter vor uns, war ein Hauseingang. Aber wer wusste, was uns dahinter erwarten würde. Ich klammerte mich an das Messer als wäre es ein Stück Treibholz und ich ein Ertrinkender.
Sie hatten uns schnell umringt. Ein Bande von vielleicht zehn Halbwüchsigen und Kindern. Ich wollte mich schon etwas beruhigen, aber ich spürte, dass Erika sich nicht entspannte, sondern ihre Angst sogar wuchs. Ich zog mir die Mütze noch ein Stück tiefer ins Gesicht. Sie unterhielten sich in einer Sprache, von der ich nur Fetzen verstand. Es klang wie das, was die Terroristen gesprochen hatten. Ich verstand, dass die Kinder Alkohol wollten; sie stanken schon so entsetzlich danach. Erika versuchte, ihre Stimme ruhig und bestimmt klingen zu lassen. Sie verlangten auch zu wissen, wer ich sei. Das fehlende Licht, meine Hautfarbe, der ihren nicht unähnlich, und die Geschichte, die ich vermeinte Erika erzählen zu hören, ließ sie ihre Aufmerksamkeit von mir abwenden.
Dann verlangten sie in forderndem Ton etwas von Erika. Als sie verneinte, sprangen blitzende Messer aus ihren Hosentaschen. Mein Arm zuckte bereits, aber Erika, vielleicht meine Bewegung ahnend, war schneller und hielt mein Handgelenk eisern auf der Höhe meiner Jackentasche. Mein Messer war nicht einmal zum Vorschein gekommen. Sie sagte leise zu mir: "Warte hier", und verschwand mit den Älteren in dem Hauseingang. Die Jüngsten, vielleicht gerade mal fünf oder sechs Jahre alt, leisteten mir mit gezückten Messern und grimmigen Gesichtern Gesellschaft, während ich wartete. Ich versuchte, mir meine Chancen auszurechnen, wenn ich einfach losrannte, aber ich wusste ja noch nicht einmal wohin.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis sie zurückkam. Die Kleinen hatten sich inzwischen mehr als genug über mich und meine vermeintliche Taubheit lustig gemacht. Das verstand ich auch ohne die Worte zu erkennen. Erikas Augen waren leicht gerötet, als wenn sie geweint hätte.
Die Bande ließ uns passieren, und ich spürte plötzlich einen starken Drang, mich zu übergeben. Erika zerrte mich davon, in die Nacht hinein. Und sie fuhr an der Stelle fort, an der sie aufgehört hatte, so als ob nichts passiert wäre.
"Armut ist so viel mehr, als nur kein Geld zu haben, weißt du. Hunger ist schlimm, aber Hoffnungslosigkeit ist so viel schlimmer. Und die Verblödung. Wenn deine einzige Sorge ist, woher du heute zu Essen bekommst, dann denkst du nur noch daran. Alles andere ist dir egal. Als die Spanier hier ankamen, beherrschten die Inka ein Reich, wie nur wenige es jemals zu solcher Größe gebracht haben. Cuzco war zu diesem Zeitpunkt viel größer als Rom, London, Paris oder Madrid. Man hatte schon gelernt so zu bauen, dass bei einem Erdbeben die Häuser stehen blieben. Es gab frischen Fisch am Hofe des Inka und das, obwohl die Küste Hunderte von Kilometern entfernt ist.
Aber das alles haben wir vergessen. Unsere Gesellschaft heute ist soviel primitiver als die Gesellschaft vor 500 Jahren. Weil wir unsere Stärken vergessen haben, weil der Hunger uns alle Gedanken nimmt, weil wir nur um das nackte Überleben kämpfen."
"Damals, nach der Großen Wirtschaftsreform haben wir noch eine Zeit lang von den paar Touristen leben können. Die Amerikaner blieben eigentlich sofort weg und schon das brachte Armut, aber ein paar Jahre lang kamen noch einige verwegene Europäer nach Peru, damals als Cuzco noch stand und noch von Peruanern bewohnt war. Aber als auch die wegblieben, da war es um Peru geschehen."
"Was wollten die Kinder von dir?", versuchte ich ihren Monolog zu unterbrechen. "Das ist meine Sache. Du denk nur daran, dass ich das alles für dich mache und dass du versprochen hast, mir ein Visum zu besorgen. Das weißt du doch noch?" Ich nickte eifrig. Auch wenn Erika mir keine Angst mehr einflößte, wusste ich, dass sie meine einzige Hoffnung war, hier wieder herauszukommen. Und außerdem hatte sie gleich mir ein Messer in der Tasche, und ich war sicher, dass sie es besser benutzen konnte als ich.
Wir schritten nun forscher aus. Es mochte vielleicht drei Uhr morgens sein und es war bitterkalt. Ich sehnte mich nach meiner heißen Dusche, wie ich mich selten nach etwas gesehnt hatte. "Es ist nicht mehr weit bis zur Sperrzone", sagte sie unvermittelt und auf Englisch.
"Ich muss schneller erzählen. Mitten in der Misere aber hat es immer Leute wie meinen Großvater und meinen Vater gegeben, die daran glaubten, dass wir es irgendwie schaffen können. Sie waren es mit ihren Freunden, die heimliche Zirkel abhielten und ihre Kinder und all diejenigen, die abends ein paar Stunden verschwinden konnten, unterrichteten. Daher spreche ich Englisch und deswegen bin ich Zahnärztin. Hast du geglaubt, hier in Peru würde irgend jemand einen Zahnarzt besuchen?" Sie lachte leise und bitter. "Es ist lange her, dass die Leute sich den Luxus leisten konnten, sich um ihre Zähne zu kümmern." Auf einmal zeigte sie in die Ferne: "Siehst du den hellen Schein? Das ist die verbotene Zone. Wir kommen näher."
"Sie formten eine Art Geheimbund, der versuchte, das Wissen im Land zu halten. Zu dem Bund gehören all die Berufe, die längst verschwunden sind: Rechtsanwälte, Ärzte, Naturwissenschaftler, sogar Philosophen und Sprachwissenschaftler. Wir haben es geschafft, dieses Wissen über ein Jahrhundert zu retten und sogar zu vertiefen. Was wir heute über die antiken Kulturen wissen, geht weit über das hinaus, was in den Büchern steht. Jedenfalls in den paar, die wir noch haben", fügte sie ein wenig verschämt hinzu. Die Lichter in der Ferne wurden immer deutlicher als hohe Scheinwerfertürme sichtbar. "Warum willst du dann nicht hier bleiben?", fragte ich sie, den Blick fest auf die sich nähernden Scheinwerfer gerichtet.
Sie zögerte ein wenig mit der Antwort. "Weil ich nicht mehr kann. Früher, als ich noch jünger war, träumte ich davon, nach Amerika zu gehen und kofferweise Bücher zu kaufen, an der besten Universität gleichzeitig mehrere Fächer zu studieren und dann mit all diesen Schätzen nach Peru zurückzukehren. Ich träumte von einem Neuanfang und davon, dass ich mit meinen Freunden wieder eine Regierung bilden würde, nach über hundert Jahren die erste. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr hungern, nicht mehr mein Elend ertragen und erst recht nicht das der anderen. Ich kann nicht mehr die Straßen entlang gehen und vor den kleinen Teufeln wegrennen, die entweder dein Leben oder deine", hier kam ein Wort, das ich nicht verstand, "wollen. Ich will mich einmal ohne Hunger und ohne Angst auf der Straße bewegen können und ich will die Chance haben, meine Künste als Zahnärztin zu beweisen. Ich will nach vorne schauen können, ohne sehen zu müssen, dass meine Mitmenschen immer mehr nach hinten verschwinden. Oh, bitte, ich muss nach Amerika. Du denkst doch an dein Versprechen? Du wirst allen sagen, dass ich dich gerettet habe, nicht wahr?"
Ich versicherte ihr, dass ich, kaum im Hotel angekommen, bereits anfangen würde von ihr zu sprechen. Vielleicht konnte sie meinen ironischen Unterton merken – obwohl es doch heißt, dass die einfachen Völker die Ironie nicht kennen – jedenfalls schaute sie mich merkwürdig an. "Unsere Vorfahren, die Inka, besaßen statt der Zehn Gebote der Christen nur drei. Aber wer diese drei nicht einhielt, der war es nicht würdig, ein Mensch unter Menschen zu sein, und dementsprechend wurde gehandelt. Das erste Gebot ist: Du sollst nicht faul sein, das zweite: Du sollst nicht töten und das dritte: Du sollst nicht lügen." Wir waren fast bei den Scheinwerfern angekommen. Ein großes weißes Tor erschien am Ende der Straße, von dem gleißenden Licht eigentümlich unwirklich beleuchtet. Es sah fast wie ein Gefängnistor aus, und doch erschien es mir wie das Tor zum Paradies.
Aber in dem Augenblick, als wir das Ende der Odyssee erblickten, hörten wir auch ein Geschrei hinter uns. Eifrige Füße kleiner, wilder Menschen waren mit einem Mal hinter uns. Die Bande war uns gefolgt, offenbar ahnend, dass etwas mit mir faul war. Erika schrie: "Lauf! Lauf um dein Leben. Ich halte sie auf. Und vergiss mich nicht! Sag ihnen, dass ich es war, die dich gerettet hat! Lauf! Lauf!" Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich nahm meine Beine in die Hand und rannte, was meine Lunge hergab. Während ich die letzten Meter zum Tor zurücklegte, hoffte ich inständig, dass die Videoanlage funktionieren würde. Hinter mir hörte ich Geschrei, aber ich drehte mich nicht um.
Schon wenige Meter vor dem weißen Ungetüm, fing ich an zu rufen. Ich schlug auf das Tor ein, aber es öffnete sich nicht. Da riss ich meine Verkleidung von mir, schmiss die vermaledeite Mütze in den Dreck, rupfte mir die Lumpen von den Füssen. Da endlich schwang das Tor auf. Ich ließ das Kriegsgeschrei hinter mir. "Ich hätte fast nicht geöffnet, Sir. Mit der Bande Wilder da draußen vor dem Tor, da hätte ich bestimmt nicht geöffnet. Zumal wir doch dachten, dass die ganze Gruppe von den Terroristen festgehalten wird. Wenn ich Ihre Nikes nicht gesehen hätte, Sir, ich hätte ganz sicher nicht geöffnet."
Ich habe meinen Job gekündigt. Ganz zum Leidwesen meiner Chefin, die mir einen wirklich schönen Abschied gab. Mit köstlichem Essen, französischem Champagner und allem Drum und Dran. Ein sehr bewegender Moment. Aber mit dem Geld, das ich durch den Prozess gegen meine Reiseagentur und den Tantiemen für die Veröffentlichung meines Buches: Lima – 2150, ungefähr (ich hatte wirklich Glück mit dem Ghostwriter) verdient habe, kann ich bequem leben. Natürlich habe ich ein paar Dinge geändert: Erika ist in meinem Buch männlich und heißt George oder so ähnlich. Auch vom Visum ist selbstverständlicherweise nicht die Rede. Ein paar Dollars übernehmen dessen Rolle in meinem Bestseller.
Ich denke nicht gerne an sie. Manchmal erinnere ich mich sogar an ihre letzten Worte und dann brauche ich immer eine schöne, heiße Dusche.
Text: Nil Thraby
[druckversion ed 06/2013] / [druckversion artikel] / [archiv: peru]