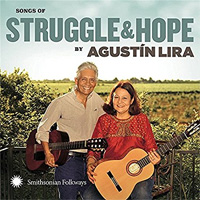ed 06/2017 : caiman.de
kultur- und reisemagazin für lateinamerika, spanien, portugal : [aktuelle ausgabe] / [startseite] / [archiv]
|
spanien: Ein Getränkeautomat und ein römischer Torbogen im Nirgendwo
BERTHOLD VOLBERG |
[art. 1] | druckversion: [gesamte ausgabe]  |
|
|
kuba: Traumhafte Duette
Interview mit der kubanischen Pianistin Marialy Pacheco TORSTEN EßER |
[art. 2] | ||
|
peru: Raftingspass in Peru
|
[art. 3] | ||
|
brasilien: Wo ist Götzes Netz?
Erinnerungen an einen untergehenden Fußballtempel THOMAS MILZ |
[art. 4] | ||
|
hopfiges: Original Medical Stout (Barcelona)
Ein Bier der La Calavera Brewery Coop. MARIA JOSEFA HAUSMEISTER |
[kol. 1] | ||
|
ausstellung: Inka - Gold. Macht. Gott.
3.000 Jahre Hochkultur VÖLKLINGER HÜTTE |
[kol. 2] | ||
|
sehen: Schwarzwalddörfer im Dschungel
SWR |
[kol. 3] | ||
|
lauschrausch: Songs of struggle & hope (Agustín Lira)
TORSTEN EßER |
[kol. 4] |
| [art_1] Spanien: Ein Getränkeautomat und ein römischer Torbogen im Nirgendwo Nach meinem Abstecher nach Plasencia bin ich im Juni 2015 weiter gewandert auf der Vía de la Plata, dem uralten Handels- und Pilgerweg, der über fast 1000 Kilometer von Sevilla nach Santiago de Compostela führt. Weil die Stadt Plasencia offiziell keine Station auf diesem Weg ist, sondern etwa ein Dutzend Kilometer östlich der Via de la Plata liegt, nehme ich frühmorgens den Bus, der mich in die Nähe des Dorfes Oliva de Plasencia bringt, wo ich mich wieder auf der offiziellen Pilgerroute befinde. Von hier muss ich acht Kilometer mitten durch Weiden marschieren, auf denen Kampfstiere gehalten werden. Zwar sind die Weiden mit Mauern und Zäunen abgesichert. Diese sind aber nicht besonders hoch und würden einen ausgewachsenen Kampfstier kaum davon abhalten, mich zu attackieren. Die Warnschilder, die an den Zäunen der Latifundien angebracht sind, tragen nicht dazu bei, mein Sicherheitsgefühl zu steigern, im Gegenteil. Nun gut, meine Angst war vielleicht übertrieben, denn rechts und links des schmalen Pilgerpfads beäugen mich jenseits der Zäune vor allem relativ kleine Jungstiere und es sind auch gar keine schwarzen dabei, sondern lieb aussehende braune und unschuldig wirkende weiße Ungetüme. Also einfach durchmarschieren ohne Aufsehen zu erregen.
Bald steht die Sonne hoch und das Thermometer nähert sich wieder den gefürchteten 40° Grad. Für Mitte Juni sind die Dehesas, die Weidegebiete mit Steineichen, schon ungewöhnlich trocken, die Dürre des Sommers hat früher eingesetzt und als warnendes Zeichen, in dieser Hitze flirrenden Einsamkeit sparsam mit meinem Wasservorrat umzugehen, liegt plötzlich mitten auf dem Weg eine vertrocknete, schon mumifizierte Schildkröte. Von meinen drei Litern Wasser ist nur noch ein halber Liter übrig und vor mir liegen noch über 20 Kilometer durch das endlose Steineichen-Panorama. Mir wird langsam schwindelig vor Hitze und Wassermangel. Und da steht er plötzlich wie eine Fata Morgana mitten in der Steppe: das Wahrzeichen der Via de la Plata, der ca. 75 nach Christus erbaute römische Torbogen, einziges Überbleibsel der damals reichen Römerstadt Capara, die nach dem Zusammenbruch des Imperium Romanum verlassen wurde. Nahezu nichts blieb übrig von dieser Siedlung, nur dieses einzigartige, vierbogige Stadttor, das heute dem müden Pilger signalisiert, dass hier ungefähr die Hälfte des Weges geschafft ist. Aktuell haben Ausgrabungen rund um das Römertor zahlreiche Grundmauern römischer Häuser zu Tage gefördert und es gibt ein Informationszentrum, in dem interessierte Besucher mehr über die untergegangene Römerstadt Capara erfahren können. Es gibt Informationsbroschüren und sogar einen Videoraum, in dem Capara virtuell wieder zum Leben erweckt wird.
Mich interessiert aber nur ein anderes Detail in diesem Besucherzentrum und das ist deutlich jünger als 2000 Jahre. In meinem Führer hatte ich gelesen, dass es dort einen Getränkeautomaten gibt (und damit die einzige Quelle für Wassernachschub im Umkreis von 20 Kilometern). Zielstrebig marschiere ich zum Besucherzentrum. Angenehme Kühle herrscht dort drinnen. Als sich meine Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten, stürzt einer der Führer auf mich zu und bietet mir an, die römische Ruinenlandschaft per Videovortrag zu erklären. Mit vor Durst heiserer Stimme lehne ich dankend ab und frage direkt und undiplomatisch (und für meine Verhältnisse erstaunlich unspirituell) nur nach dem einzigen, sehr profanen Ziel meiner Wünsche: dem Getränkeautomaten. Das Auffüllen meines Wasservorrats soll sich noch als fundamental erweisen, denn vor mir liegen 20 Kilometer Marsch durch schöne, aber endlos scheinende Dehesas. Am Horizont begleitet mich die verschwommene Silhouette der Sierra de Gredos beim fast pausenlosen Marsch nach Norden. In der Extremadura stimmt der Satz, dass Spanien anders ist, immer noch. Denn im Rest Europas gibt es am Straßenrand wohl kaum Warnschilder, dass hier Stiere die Fahrbahn überqueren. Leider wurde diese schöne und fast menschenleere Landschaft im äußersten Norden der Extremadura vor ein paar Jahren durch eine Autobahn zerschnitten und dies ist wohl der Grund für viele leer stehende Bauernhaus-Ruinen in der Gegend. Nachdem sie durch den Autobahnbau einen wesentlichen Teil ihrer Ländereien verloren hatten, gaben viele Bauern offenbar auf und zogen in die Stadt. Zurück blieben teils bizarre Hausruinen - auf einer hat der geflüchtete Eigentümer in großen Lettern geschrieben: "Jesús, confío en tí" (Jesus, ich vertraue auf Dich). Hoffen wir mal, dass er nicht enttäuscht wurde.
Wie in Trance wandere ich durch die mit Steineichen durchsetzte Steppe, um irgendwann nach 32 Kilometern und sechs Litern Wasser tatsächlich an meinem Etappenziel anzukommen: Aldeanueva del Camino. Ein hübsches Dorf mit vielen Gärten, einer alten Brücke und einem extrem stressfreien Ambiente. Vor dem Abendessen sitze ich neben dem gemütlichen Rathausplatz, wo zwei Jungen Federball spielen. Plötzlich unterbricht einer der beiden abrupt das Spiel, blickt zu mir rüber und fragt, ob ich Deutscher sei. Erstaunt über soviel Scharfsinn sage ich "Ja." Das ist der Beginn einer unverhofft lustigen Unterhaltung, denn nun texten mich beide Jungs mit (halb) deutschen Sätzen zu. Ihr Deutsch klingt erstaunlich gut und sie verraten mir, dass sie nervös seien, weil sie in zwei Tagen eine wichtige Deutschprüfung an einer Privatschule hätten (Niveau A1). Ich kann sie beruhigen, weil sowohl ihre Aussprache als auch ihr reichhaltiger Wortschatz gut und sehr talentiert klingen. Sie lassen aber nicht locker und wollen unbedingt mit mir für die Prüfung üben. Abwechselnd tragen sie nun längere, oft fehlerhafte Sätze auf Deutsch vor und fragen, ob es Fehler zu korrigieren gebe oder alles so richtig sei. Ich bin kurz etwas überfordert mit dieser ungewohnten Lehrerrolle, denn ich war auf der Vía auf alle möglichen Herausforderungen eingestellt: Hitze über 40° Grad, wilde Stiere, die links und rechts lauern, geschlossene Herbergen - aber nicht auf Kinder, die mich nach einem 32-Kilometer-Marsch für eine abendliche Deutschstunde verpflichten. Ich korrigiere ihren Satzbau nach bestem Wissen und Gewissen, aber als sie nach Erklärungen der Grammatik verlangen, flüchte ich mich in Ausreden und versuche das Gespräch auf Fußball zu lenken (Fußball geht immer).
"Ich hasse Fußball!", platzt es (auf Deutsch) aus dem älteren der beiden Jungen heraus (er ist 13). Er würde sich lieber mit "wirklich wichtigen" Dingen beschäftigen. Oha, da hat sich mir wohl das einzige intellektuelle Kind dieses Dorfes vorgestellt. Er beeilt sich zu versichern, dass er sowohl Messi als auch CR7 "blöder als blöd" fände und statt Zeit mit Fußball zu verschwenden lieber lesen würde. Der jüngere der beiden meint, er fände Ronaldo schon gut, allein wie der sich immer vor Freistößen hinstellte das sähe echt cool aus. "Quatsch! Du hast ja keine Ahnung, Fußball macht die Leute blöd!", weist ihn der ältere Bruder zurecht. OK, also kein Fußball. Das Gespräch kehrt zurück zur Deutschprüfung und ich versuche vergeblich, den Unterschied zwischen Dativ und Genitiv zu erklären (allerdings verstehen auch die meisten Deutschen den schon lange nicht mehr...). Zum Glück werden die beiden dann von der Mutter zum Abendessen gerufen und ich wünsche ihnen viel Erfolg für die Prüfung. Und ich muss kurz nach Sonnenuntergang ins Bett, denn morgen muss ich kurz vor sechs Uhr weiter marschieren. Text + Fotos: Berthold Volberg Tipps und Links: Unterkunft in Aldeanueva del Camino Pilgerherberge "La Casa de mi Abuela", (Calle Alcázar 4), eine der besten Herbergen auf dem ganzen Weg, Übernachtung für 13 Euro, bietet auch Waschmaschine und Trockner, Mikrowelle, Kochgelegenheit und WLAN. www.turismoextremadura.com [druckversion ed 06/2017] / [druckversion artikel] / [archiv: spanien] |
| [art_2] Kuba: Traumhafte Duette Interview mit der kubanischen Pianistin Marialy Pacheco Die kubanische Pianistin Marialy Pacheco, die "größte unter den jungen Pianotalenten" wie Chucho Valdès sie lobte, hat sich auf ihrem neuen Album ein paar Träume erfüllt. Und: Sie ist nun deutsche Staatsbürgerin. Wie hast Du Dir deine Duett-Partner ausgesucht? Begonnen hat alles damit, dass Eva Bauer mich fragte, ob ich nicht noch eine Platte machen wolle. Dann habe ich mit meinem Manager Klaus [Wingensiefen] überlegt, was ich machen könne, und da ich zuvor schon solo und im Trio Alben aufgenommen hatte, kamen wir auf Duette. Ich habe dann eine Liste von meinen Lieblingsmusikern erstellt, Musiker mit denen ich schon lange zusammen spielen wollte. Da standen Pat Metheny, Mariza, Avishai Cohen, Michel Camilo u.a. drauf, eine "Traumliste" eben. Wir haben alle angeschrieben und Miguel Zenón, Hamilton de Holanda, Omar Sosa und Max Mutzke haben spontan zugesagt, andere hatten keine Zeit, und manche haben nicht geantwortet. Bei Michel Camilo hat sein Label einer Zusammenarbeit nicht zugestimmt. Mit Omar Sosa geht es los… Ich wollte unbedingt mit einem Pianisten - oder zwei – Titel einspielen. Mit Omar bestand bereits Kontakt, einmal weil er mir zu meiner Platte "Introducing…" gratuliert hatte und zum anderen weil er meine Tante auf Kuba kennt. Sie ist auch Musikerin und ich hatte ihm bei einem Konzert Grüße von ihr bestellt. Als er das Konzept von "Duets" gelesen hat, war er sofort dabei. Sowohl er wie ich haben zum ersten Mal mit einem anderen Pianisten etwas eingespielt. Aber obwohl wir unterschiedliche Spielweisen haben, gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen uns. Das hört man besonders gut auf dem Bonustrack. Das war eine Probe, von der wir nicht wussten, dass der Techniker sie mitschneidet. Wir kamen rein, ich habe mich an meinen Bösendorfer gesetzt, Omar an einen Steinway und dann haben wir angefangen. Der reguläre Titel auf der CD ist von Omar. Er ist ein sehr spiritueller Mensch und so ist auch sein Stück, wunderbar tief und spirituell. Erlebt man Duette mit zwei Pianos so selten, weil dort die Gefahr der Konkurrenz größer ist? Vielleicht, aber bei uns war das kein Problem. Wir sind uns da sehr ähnlich: es geht nicht um Konkurrenz, sondern um den Dialog. Das ist übrigens auch meine Herangehensweise bei den anderen Duetten. Bei mir geht es immer nur um die Musik. Ich denke, als Profi muss man irgendwann an einen Punkt kommen, wo es nicht mehr wichtig ist, sich profilieren zu müssen. Haben alle Duett-Partner Stücke mitgebracht? Bei der Auswahl der Musiker war mir wichtig, dass sie eine starke musikalische Identität haben, dass man sie mit geschlossenen Augen nur am Klang erkennt. Also musste ich Stücke aussuchen, die das unterstreichen. Von Hamilton habe ich viele Platten durchgehört und dachte bei "Capricho do sul", dass es sich gut auf Klavier übertragen lässt, denn das ist nicht so einfach von der Mandoline her, bei der alles nah zusammen liegt. Außerdem gibt es harmonisch Platz für Improvisation, das war mir wichtig, und es ist rhythmisch, denn wir haben ja sonst keine Begleitung. Bei Miguel und seinem Klang dachte ich direkt an "La comparsa" von Ernesto Lecuona und konnte mir die Melodie schon auf dem Saxophon vorstellen. Ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich höre, wie er beginnt zu spielen. Wir haben zwei takes gebraucht, fertig, auch weil ich wusste, dass er sich mit dem Stück identifizieren konnte. Kuba und Puerto Rico liegen ja nicht so weit auseinander. Max habe ich auf einem Festival getroffen und wollte unbedingt etwas mit ihm aufnehmen. Das Stück von ihm ist auf seiner Platte sehr poppig, aber ich dachte direkt daran, daraus eine Jazzballade zu machen. Max erzählte dann, dass er diesen Song bisher nie live gesungen habe, aber es mit meinem Arrangement gerne machen würde. Mit Rhani spiele ich momentan ohnehin in einem Duo-Projekt. "Burundanga" ist ein Arrangement, das ich zunächst für mein Trio geschrieben habe. Der Titel ist perfekt für Rhani. Da kann er alles zeigen, es gibt ruhige Passagen, aber eben auch den groovigen Mittelteil. Joo wiederum arbeitet sehr viel mit Effekten bei seiner Trompete. Darum habe ich meinen Titel "Metro" ausgewählt, der dadurch spaciger wird, und in dem es um den Traum von einer U-Bahn in Havanna geht. Bei der Auswahl aller Titel habe ich mich immer an der Persönlichkeit der "Jungs" orientiert. Warst Du nochmal in Havanna? Vergangenes Jahr habe ich ein Privatkonzert für den Deutschen Botschafter dort gegeben, zusammen mit meinem Bruder, der auch Pianist ist. Danach spielten wir noch ein Konzert im Theater Bellas Artes. Und wann wird Havanna eine Metro haben? Niemals (lacht!). Dann passt der Science-Fiction-Sound von Joo Kraus ja gut… Ja, genau, das ist Science Fiction… Wie kamst Du auf die Idee, mit Dir selbst im Duett zu spielen? Das ist Klaus schuld. Es sagte, wenn ich mit anderen spiele, dann solle ich doch auch mit mir im Duett spielen. Ich war überrascht, aber fand die Idee dann cool. Und dann habe ich mir noch einen Titel von Lecuona ausgesucht und ihn für zwei Flügel arrangiert. Der Studiotechniker war verwirrt als ich erst den einen und dann den anderen Part aufnahm. Dann habe ich das gleiche mit dem mexikanischen Volkslied "La bikina" gemacht. Und mit dem "Imperial" klingt das wie ein Orchester. Er hat ja fünf schwarz gemalte Extra-Tasten mit tiefen Tönen, die den Resonanzkörper vergrößern. Spielen tut man sie normalerweise nicht, aber der Klang ist trotzdem wahnsinnig. Wenn ich die international bekannten Jazzpianisten aus Kuba aufzähle, ist nur eine Frau dabei: Du! Wie kommt das? Das ist richtig, einerseits cool, andererseits werde ich manchmal nicht so ernst genommen wie die Männer. Ich muss immer ein wenig mehr kämpfen, denn 1. bin ich Latina, da kommen dann schon viele Klischees hoch und 2. eine hübsche Frau, darum denken viele ich müsste auch singen… die Frage danach hasse ich am meisten, zumal ich keine schöne Singstimme habe. Und Musik sollte nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Für mich geht es immer nur um Qualität, egal ob Frau oder Mann. Aber nach meinem Konzert ist das dann auch klar. Das gute kubanische Musikerziehungssystem durchlaufen ja auch viele Frauen, zumindest habe ich am Konservatorium in Havanna viele gesehen. Wo bleiben die danach? Für den Jazz kann ich sagen, dass der Weg dorthin hart ist. Denn wir werden ja klassisch ausgebildet und wenn du Jazz spielen willst, musst du dir das selbst beibringen: von Platten, auf der "Straße" etc. Ich wollte das unbedingt, aber das halten Frauen vielleicht nicht so gut durch. Und auch in den populären Salsa-Bands, wo man etwas anderes lernen könnte, werden i.d.R. als Musiker nur Männer engagiert, die Frauen dürfen singen. Und dann kommt noch das überall gleiche Problem hinzu: Frauen wollen evtl. Familie haben und das kollidiert dann mit einer Musikerkarriere. Text: Torsten Eßer Cover: amazon Tourtermine: 5.7. Montreux, Jazzfestival 22.09. Viersen, Jazzfestival 26.09. Berlin, Piano Salon Christophori [druckversion ed 06/2017] / [druckversion artikel] / [archiv: kuba] |
|
[art_3] Peru: Raftingspass in Peru
Peru durchkreuzen zahlreiche Flüsse. Das sind 7.000 Flußkilometer von Lima bis Iquitos und von Tumbes bis Cusco. Für Raftingbegeisterte bedeutet das viel Abwechslung. Dabei ist für alle etwas dabei, denn die Schwierigkeitsgrade reichen von I bis V. Ein reißendes Vergnügen für Anfänger wie Könner – und das vor magischer Kulisse.
Rafting in den Anden: der Rio Apurimac bei Cusco Der Apurimac zählt zu den bekanntesten Rafting-Zielen in Peru und hat die Schwierigkeitsgrade II, III und IV. Der sehr tiefe Fluß entspringt südwestlich von Caylloma auf über 5.000 Metern und schlängelt sich durch beeindruckende Landschaften hinunter zu den heißen Quellen von Cconoc in Curahuasi. Insgesamt überwindet der Apurimac über 600 Kilometer und mehr als 3.500 Höhenmeter. Verschiedene Anbieter organisieren Touren jeder Art, beliebt sind Mehrtagestouren mit zwei Übernachtungen. Von Cusco aus geht es vier Stunden durch die Anden bis zur Einstiegsstelle an der Brücke Huallpachaca, hier startet der nasse Nervenkitzel der mehrfach unter die 10 besten Raftingtouren der Welt gewählt wurde. Die Stromschnellen haben vielsagende Namen wie „Zahnschmerz“, „du zuerst“ oder „letztes Lachen“. Gekrönt wird jede Tour vom Anblick der Salkatany-Bergkette, einer der schönsten Kordilleren der Welt.
Rafting an der Pazifikküste: der Rio Cañete südlich von Lima Der Fluss Cañete liegt südlich von Lima inmitten dem fruchtbaren Obst- und Weinanbaugebiet Lunahuaná, einem beliebten Ausflugsziel der Hauptstädter. Mit zahlreichen Passagen der Schwierigkeitsstufe V, hohen Wellen und aufbrausenden Stromschnellen zählt der Cañete zu den beliebtesten Raftinggebieten in Lateinamerika. Von Halbtagestouren aller Niveaus bis hin zu Mehrtagestrips von den Ausläufern der Anden bis zur Pazifikküste ist für jeden das richtige Angebot dabei. Eines ist sicher: Das Adrenalin fließt dabei schneller durch die Adern als das Wasser den Cañete hinunter. Wer anschließend etwas Erholung nötig hat, sollte eine Verlängerung in einem der umliegenden Weingüter buchen.
Rafting im Regenwald: der Amazonas Ein ganz besonderes Erlebnis ist eine Raftingtour auf dem gewaltigen Amazonas, der zweitlängste Fluss der Erde. Wer keine Lust auf die herkömmlichen Schlauchboote hat kann sich unter Anleitung des Guides sein eigenes Schilffloß basteln und sich darauf durch die Fluten tragen lassen. Einmal im Jahr blickt die internationale Raftingwelt nach Iquitos im peruanischen Amazonasgebiet, denn dann findet „The River Amazon International Raft Race“ statt, laut dem Guinness Buch der Rekorde das längste Floßrennen der Welt. Seit 1999 geht es jedes Jahr im September oder Oktober für die vielen hundert Teilnehmer während drei Tagen über 180 Kilometer den Fluß hinunter.
Weitere beliebte Rafting-Destinationen in Peru: Río Mayo und Río Huallaga in Tarapoto im Dschungel, Río Cotahuasi zwischen Ica und Arequipa, Austragungsort des Sportfestivals von Cotahuasi“, Río Urubamba im Valle Sagrado, dem Heiligen Tal der Inka, Río Colca mit 300 Stromschnellen entlang einer der tiefsten Schluchten der Welt oder Río Tambopata, der spektakulärste Fluss Perus im gleichnamigen Schutzgebiet. Weitere Informationen unter www.peru.travel/de [druckversion ed 06/2017] / [druckversion artikel] |
|
[art_4] Brasilien: Wo ist Götzes Netz?
Erinnerungen an einen untergehenden Fußballtempel Als ich vor zwanzig Jahren zum ersten Mal nach Rio de Janeiro flog, riet mir mein Vater zu einem Besuch im Maracanã. Er selbst hatte in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in der wundervollen Stadt gelebt, damals als Pelé in dem weiten Rund seine Traumtore schoss. Ich solle nur vorsichtig sein, weil die Fußballfans auf den oberen Rängen in Plastiktüten pinkeln würden, die sie dann auf die unteren Ränge schmissen. Seitdem schaue ich bei meinen unregelmäßigen Besuchen in dem weiten Rund stets misstrauisch nach oben. Kommt da wohl was?
Ich erinnere mich an ein tolles Fla-Flu, den Klassiker zwischen Flamengo und Fluminense. Damals war das Maracanã noch jener Mega-Tempel, ein Status, den es nach den ständigen Umbauten ab 2007 verlor. Bis zu 200.000 Zuschauer sollen einst in die Schüssel gepasst haben, liest man. Wie beim entscheidenden Spiel zwischen Brasilien und Uruguay bei der Weltmeisterschaft 1950. Kurz zuvor war das Stadion "fertig gestellt" worden; angeblich wurde noch während der WM hier und da gewerkelt. Mário "Lobo" Zagallo hat mir einmal in einem Gespräch erzählt, was damals geschah. Als junger Soldat war er für die Sicherheit im Stadion abgestellt worden. Vom Spiel habe er nichts gesehen, musste er doch die Zuschauer im Blick behalten. Mit dem Rücken zum Spielfeld verpasste er deshalb jenes 2:1 für Uruguay, das Brasilien den sicher geglaubten WM-Sieg kostete. Es sei plötzlich totenstill geworden, so Zagallo. In den Gesichtern der Zuschauer habe er das Ausmaß des Schocks ablesen können. Zagallo wurde 1958 und 1962 als Spieler Weltmeister, 1970 als Trainer. Doch Brasilien konnte auch 2014 nicht den WM-Pokal im Maracanã gewinnen, wie wir ja wissen. Dabei hatte man das Stadion vor der Heim-WM 2014 komplett umgebaut. Zweimal besichtigte ich die Baustelle. Ob es pünktlich zum ConFedCup 2013 fertig werden würde? Es klappte, Ende April 2013 wurde das neue, nun nur noch 78.000 Zuschauer fassende Maracanã mit einem lockeren Kick der "Freunde von Bebeto" gegen die "Freunde von Ronaldo" eingeweiht. Das Spiel war nicht so spannend, aber Vorfreude lag in der Luft. Zwar hatten sich damals Demonstranten auf die Tribünen geschlichen und gegen den Umbau und die geplante Privatisierung protestiert. Ansonsten herrschte aber gute Laune.
Anfang Juni 2013 folgte dann das Freundschaftsspiel Brasilien gegen England, ein unterhaltsamerer Kick ohne Demonstranten, dafür vor vollem Haus. Und mit einem Traumtor von Wayne Rooney. Toll war die Stimmung damals im weiten Rund, das 2:2 gab Hoffnung für die anstehende WM. Während der sah ich hier die spanischen Weltmeister gegen die chilenische "La Roja" untergehen. Chilenische Fans hatten zuvor den Presseeingang gestürmt und versuchten sich vor den FIFA-Ordnern auf den überfüllten Tribünen zu verstecken. Irre Jagdszenen spielten sich ab. Auch das Spiel war für die Ewigkeit. Genau wie das WM-Finale zwei Wochen später. Auf der Pressetribüne war ich vor den Pinkelbeuteln der enttäuschten Argentinier sicher. Bis zum Schluss des Titel-Fests blieb ich im Stadion, mit anderen Fans jubelte ich den deutschen Spielern zu, bis alle weg waren. Als letzter verließ Poldi den Platz, den Pokal in der Hand. Obwohl er bei der WM keine einzige Minute gespielt hatte. Hinter ihm trottete sein kleiner Sohnemann vom Platz. Das war es also, Weltmeister im Maracanã, und das gegen Argentinien mit Messi. Besser geht es nicht, besser wird es niemals wieder werden. Die eigenen Leute als Weltmeister im Maracanã zu feiern, das habe ich Zagallo voraus. Fast drei Jahre später gehe ich über den braunen Rasen zu dem Tor, auf das Mario Götze 2014 in der 113. Minute geschossen hat. Doch wo ist das Netz, in das sein Ball auf magische Weise einschlug? Die Sitze, die im weiten Rund ebenfalls fehlen, finden wir unter der Rampe des Haupteingangs, einfach in den Dreck geworfen. Die olympischen Ringe stehen ein paar Meter weiter hinter einem Abstellhäuschen, halb eingehüllt in eine Plastikplane. Ich könne sie ja mitnehmen, schlägt mir ein Wachmann vor. Man wisse nicht, wohin damit... Text + Fotos: Thomas Milz [druckversion ed 06/2017] / [druckversion artikel] / [archiv: brasilien] |
|
[kol_1] Hopfiges: Original Medical Stout (Barcelona)
Ein Bier der La Calavera Brewery Coop. Die letzte offizielle caimán-Bier-Verkostung liegt schon einige Monate zurück. Den Grund lieferte die Osteopathie: Meinen Darm solle ich mal aus seiner Lethargie reißen. Schuld an der Trägheit sei in erster Linie Antibiotikum-Missbrauch im Rahmen einer Borreliose Anfang der Neunziger Jahre. Mich hatte in Guatemala, Belize, Mexiko oder doch im Kölner Volksgarten eine Zecke infiziert. Oder vielleicht nur eine Mücke. Ich hab’s nie erörtern können. Borreliose war damals noch wenig bekannt und so drückte mir jeder Arzt, den ich hoffnungsvoll aufsuchte, Antibiotikum rein – obwohl die Erreger bereits nach der ersten Antibiotikum-Kur nicht mehr im Blut nachweisbar waren.  å« Aus heutiger Sicht unglaubliche, wilde Zeiten mit ein paar schießwütigen, harten Ärzten in der Hauptrolle: "Ach Jung, nimm mal das ne Woche. Ist ein Breitband Antibiotikum. Damit bist du alle Sorgen los." Zurück zur Osteopathie. Mein ewiges Leiden heißt "heiße Füße". Zum Schlafen eine Decke über den Füßen ist nicht vorstellbar. Und sobald der Sommer naht, verbringe ich nachts mehr Zeit im Eisbecken als ruhend. Irgendwann entsteht im Leben dann ein Kreislauf. Neben Eiswasser hilft Bierchen. Im Laufe der Jahre mehren sich die kleinen Wehwehchen und auch hier hilft Bierchen. Das war die Zeit, in der sich das kleine trotzige Mädchen namens Olga mit dem ewig garstigen Blick in meinem Darm einzunisten begann. Anfangs seltener, mit der Zeit häufiger und dann fast permanent klopfte die Kleine, links und rechts ein leeres Glas in der Hand, auf ihren Tresen und der Darm signalisierte dem Belohnungsareal im Hirn: "Bierchen wäre jetzt ne feine Sache." Glücklicherweise sind meine Suchtgene nicht allzu ausgeprägt und so gab sich Olga morgens mit einem Bierchen zufrieden. Wenn ich dann nachmittags noch mal zwei bis drei nachlegte, gab die trotzige Olga sogar ganz Ruhe. Die Osteophatie bearbeitete meinen Rücken und verordnete neben Mineralöl, Algen und Urgesteinsmehl die Schüssler Salze Nummer 7 und 12. Die Wirkung war bombastisch. In mich und meinen zwanghaft gemütlichen Darm kehrte Leben zurück. Tolles Leben mit viel Lust auf Neues. Die sensationelle Entdeckung aber schreib ich den Salzen zu. Mit dem ersten Tag der Einnahme war Olga verschwunden. Das Verlangen nach Bierchen war wie weggeblasen. Es vergingen oft mehrere Tage, in denen ich nichts trank und nicht einen Gedanken an Bierchen verschwendet hätte. Die Osteopathie meinte nach ein paar Wochen, es sei genug, ich könne die Dosis halbieren und dann auch ganz einstellen, je nachdem was mein Gefühl sage. Da die Beschleunigung des Darms sich nicht auf meine heißen Füße ausgewirkt hatte, ich mich aber mittlerweile echt fit fühlte, setzte ich Nr. 7 und Nr. 12 ab. Olga kam zurück. Weniger vehement als zuvor, aber sie war wieder da. Das war auch gut so, denn der Spanien-Urlaub stand an und nach so viel Inaktivität, sollte die Kolumne Hopfiges wiederbelebt werden. Im Wine Palace stachen mir drei unbekannte Biere ins Auge: 1. Ein unaufdringliches, sicherlich solide erfrischend nach klassischem Bier schmeckendes. 2. Ein zweites, aus der Craft-Szene stammendes und den üblichen Zitrus-Hopfen aus den USA nutzendes. 3. Ein Medizinfläschchen, bei dem ich drei Mal hinschauen musste, um tatsächlich fassen zu können, dass es Bier enthalten solle.
Jetzt wird's ernst Die Wahl als Startbier fiel auf das mehr als exotische Medizin-Bier. Zur Verkostung erhielt ich Beistand von Eva und Andrea. Und der war auch bitter nötig... Maria Josefa noch mit dem Versuch dem Bier mit Respekt zu begegnen: Bitte beschreibt zunächst den Geruch. Andrea reißt den Kopf angewidert zur Seite: Was ist das denn? Das ist doch nicht deren ernst. Das riecht nach Füßen... nach einer mehrstündigen Wanderung bei 40° C. Eva (Labor): Pökelsalz! Bedacht darauf, nur einen winzigen Schluck abzubekommen, setzen wir die Gläser an die Lippen. Maria Josefa: Ich wusste gar nicht, dass altes Öl aus dem Auto prickelt. Wenn auch nur minimal. Andrea schüttelt sich: Ist das widerlich. Ist das ekelhaft. Bier aus Jahrzehnten alten Flaschen, die vor der erneuten Abfüllung nicht gereinigt wurden. Eva (Labor) ist immer noch um Ernsthaftigkeit bemüht: Herausschmecken tue ich Fernet Branca, der mit – ihr Blick wandert, das richtige Wort suchend, in die Höhe – Maggi!, ja wirklich reichlich Maggie versetzt wurde. Dann bricht auch sie vor Schmerz zusammen. Fazit Im Wine Palace das Regal, in dem das original Medical steht, der Gesundheit zuliebe weiträumig umgehen. Auch wenn Olga noch so bittet und bettelt. Und was die beiden anderen zu verkostenden Biere betrifft: Nach dem Medical-Stout-Schock wird es frühestens in der nächsten caimán-Ausgabe weitere Test-Berichte geben. Text + Fotos: Maria Josefa Hausmeister [druckversion ed 06/2017] / [druckversion artikel] / [archiv: hopfiges] |
|
[kol_2] Ausstellung: Inka - Gold. Macht. Gott.
3.000 Jahre Hochkultur Für die Inka waren es „Perlen der Sonne“, die Spanier sahen nur den materiellen Wert. Während Gold für die Inka und ihre Vorgängerkulturen ausschließlich rituellen Charakter besaß und nur höchsten Herrschern und Priestern vorbehalten war, strebten die spanischen Conquistadores nach schnellem Reichtum. Erzählungen von einem sagenhaften „El Dorado“ hatten sie an das andere Ende der Welt gebracht. Der Mythos des Inka-Goldes hat in dieser Unversöhnlichkeit zweier Wertesysteme ihren Ursprung. Nach „InkaGold“ (2004/2005) nimmt das Weltkulturerbe Völklinger Hütte erneut und mit neuen Exponaten die faszinierenden Hochkulturen der Inka- und Vor-Inka-Zeit in den Blick.
Die Ausstellung „Inka – Gold. Macht. Gott.“ zeigt in 220 einzigartigen Exponaten die Faszination der alten peruanischen Hochkulturen und ihr Aufeinandertreffen mit der europäischen Kultur des 16. Jahrhunderts. Der Kern-Bestand der Exponate stammt aus dem Larco Museum, Lima und Cusco, das die größte Privatsammlung altperuanischer Kunst weltweit besitzt. „Inka – Gold. Macht. Gott.“ ist eine Ausstellung mit herausragenden Exponaten zur Kultur der Inka und ihrer Vorgänger-Kulturen, die in dieser Form und Zusammensetzung zum ersten Mal zu erleben ist. Sie zeigt die Kultur der Inka und ihrer eroberten Reiche und Vorfahren. Die Inka sahen ihre Vorgänger-Kulturen als ihre Lehrmeister an. Zu sehen sind die berühmten Goldexponate der Moche, die meisterhaften Metallarbeiten der Chimú, aber auch herausragende Textilien und Keramik. Das Gebiet der Inka umfasste das Territorium aller dieser Vor-Inka-Kulturen wie Nasca, Moche oder Chimú und baute darauf auf. Die berühmten Goldschmiede der Chimú beispielsweise blieben auch in der Inka-Kultur führend. Die Ausstellung im Weltkulturerbe Völklinger Hütte wird so zu einer 3.000 Jahre umfassenden Kunst- und Kulturgeschichte, die in der Hochkultur der Inka mündet.
Die Inka waren das größte Weltreich ihrer Zeit. Ihre Knotenschrift, die Quipu, ist trotz moderner Hochleistungscomputer bis heute nicht entziffert. Daher sind die Objekte der Inka-Ausstellung nicht nur beeindruckende Kunstwerke, sondern sie erzählen uns, wie die Inka und ihre Vorgänger-Kulturen lebten und wie sie ihre Welt sahen. Und nicht selten sind die Objekte sogar die primäre Quelle, um etwas über diese Welt zu erfahren. Die Exponate erzählen von rituellen Zweikämpfen, die mit der Opferung des Besiegten endeten, von Fruchtbarkeitsritualen und der zentralen Bedeutung des Wassers. Themen sind die duale Weltsicht von Oberwelt und Unterwelt, die Welt der Krieger, die Darstellung von Sexualität, Rauschmittel und der sagenhafte Schmuck der Könige. Die Objekte erzählen von einem riesigen Reich, das Küste, Wüste, Bergwelt und Dschungel umfasste. Und natürlich handelt die Ausstellung auch von dem Gold der Inka, wegen dem die Spanier sich auf den Weg gemacht hatten.
Die spanische Eroberung Südamerikas durch Francisco Pizarro ist ein wichtiges Thema der Ausstellung. Sie zeigt den Punkt, an dem zwei Welten aufeinandertrafen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist weltweit das einzige Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung, das vollständig erhalten ist, und bewahrt so das Erbe der Industrialisierung für kommende Generationen. Regelmäßig bietet das Weltkulturerbe Völklinger Hütte auch anderen Welt-Kulturen ein Forum und schafft so einen Raum für einen Dialog zwischen den Kulturen. Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin des Saarlandes, der Botschaft von Peru in Deutschland, der Österreichischen Botschaft in Deutschland und der Französischen Botschaft in Deutschland. Gold – Konflikt zweier Sichtweisen Gold stand in der Andenregion für die Oberwelt der Götter und für die Macht der Herrschenden, die als legitime Vertreter der Götter auf Erden walteten. Silber verkörperte das weibliche Prinzip sowie die Unterwelt mit den Verstorbenen. Kupfer stand für die irdische Welt der Lebenden und für den Opferkult, mit dem das irdische Gleichgewicht und die landwirtschaftliche Ernte gesichert wurde. Die Kunsthandwerker galten als privilegierte ‚Zauberer‘, die zwischen Göttern und Menschen vermitteln und symbolhafte Metalle in unvergängliche, kostbare Objekte verwandeln konnten. Als die Spanier das Gold und Silber der Inka einschmolzen, zerstörten sie auch diesen Glauben und damit die Kultur der Inka. Eine Mischung aus Zufällen, Epidemien, Kriegstechnologie und äußerste Entschlossenheit gaben den Ausschlag für den Erfolg der Konquistadoren um Francisco Pizarro. Mit einer winzigen Schar von weniger als 200 bewaffneten Spaniern gelang es ihm, das riesige Inka-Reich zur erobern. Ein Faktor waren Waffen und Rüstung aus Eisen. Die Inka kannten weder Pferde noch Stahl und Schießpulver und konnten dem nichts entgegensetzen. Die Ausstellung „Inka – Gold. Macht. Gott.“ zeigt diese Rüstungen, Feuerwaffen, Armbrüste und Schwerter, die für die Inka Erzeugnisse einer unbekannten Welt waren. Francisco Pizarro erpresste von dem gefangenen Inka-Herrscher Atahualpa ein sagenhaftes Lösegeld. Die wenigen noch erhaltenen Schmuckstücke und Kultobjekte zeugen noch heute von der Lebendigkeit des altperuanischen Kunsthandwerks. Als diese göttlichen und herrschaftlichen Symbole durch Plünderung, Zerstörung und Einschmelzen verloren gingen, glaubten die präkolumbischen Völker, dass damit auch ihre Verbindung zu den Vorfahren abgerissen sei. Insgesamt gelangten zwischen 1532 und 1540 mindestens 181 Tonnen Gold und 16.800 Tonnen Silber über den Atlantik nach Europa. Die Ausstellung „Inka – Gold. Macht. Gott.“ zeigt die Kultur und Weltsicht, die damit zerstört wurde. Eine herausragende Exponaten-Gruppe der Ausstellung im Weltkulturerbe Völklinger Hütte sind die kaiserlichen Grabbeigaben aus der Chimú-Kultur. Die Krone, das Pektoral, die Kette, Epauletten und Ohrscheiben zeugen von der Macht des Herrschers und symbolisieren dessen göttliche Kraft. Bis heute ist dieses Ensemble aus goldenen Grabbeigaben das einzige, das in einer offiziellen Sammlung verzeichnet ist. Von der hohen Symbolmacht, die die Inka Gold- und Silberfiguren zumaßen, zeugen heute nur noch wenige Objekte in peruanischen und internationalen Museen. Meist zeigen diese Figuren Paare von hohem gesellschaftlichem Status, die für die duale Weltsicht (Oberwelt/Unterwelt, Mann/Frau, Gold/Silber) der präkolumbischen Andenvölker steht. Die Figuren eines nackten Mannes und einer nackten Frau, die in der Ausstellung „Inka – Gold. Macht. Gott.“ zu sehen sind, zählen zu den wenigen erhalten Inka-Objekten dieser Art. Bisweilen legte man solche Figuren dem obersten Inka ins Grab, damit sie ihn auf seiner Reise in die Unterwelt der Ahnen begleiteten. Eine große Rolle in Zeremonien des Andenraums hatten Masken. Bei Bestattungen setzte man den Verstorbenen Totenmasken auf, um deren Verwandlung in die dargestellte Mythenfigur zu symbolisieren. Denn nur so konnte ein Herrscher aus der Unterwelt wieder in die ‚Oberwelt‘ der Götter aufsteigen und von dort aus für das Wohl seines Volkes sorgen. Totenmasken, die die vergöttlichte Identität des Ahnen darstellten, sollten dem Verstorbenen bei seiner Reise in die Totenwelt zur Seite stehen. In der Ausstellung „Inka – Gold. Macht. Gott“ ist eine Totenmaske der Gottheit Ai Apaec aus der Moche-Kultur zu sehen. Eine zentrale Rolle in den altperuanischen Kulturen spielten Opferzeremonien, die vor allem der Sicherung der Fruchtbarkeit dienten. Opfermesser, Schalen und Becher für zeremonielle Flüssigkeiten sowie Darstellungen von rituellen Zweikämpfen, gefangenen Kriegern oder eines mythischen „Enthaupters“ in der Ausstellung „Inka – Gold. Macht. Gott.“ zeugen von der zentralen Bedeutung dieser Opferrituale. Bei diesen Tier- und Menschenopfern beteiligten sich die politisch-religiösen Würdenträger. Den Geopferten wurde die Kehle durchgeschnitten, bevor das Opferblut in aufwändigen Zeremonien aufgefangen und den Göttern dargeboten wurde, um sie milde zu stimmen. Die Götter sorgten im Glauben der altperuanischen Kulturen im Gegenzug für den nötigen Regen und bewahrten die Menschen vor Naturkatastrophen. Aus der Moche-Kultur sind in der Ausstellung Ohrpflöcke zu sehen, die den mythischen Kriegervogel zeigen. Es gab rituelle Kämpfe, bei denen ähnlich gekleidete Krieger gegeneinander kämpften. Der Besiegte wurde entkleidet und als Opfer in Zeremonien getötet. In Schmuckarbeiten wie diesen Ohrpflöcken entfaltete sich der Prunk der altperuanischen Herrscher besonders eindrucksvoll. In enger Zusammenarbeit fertigten Goldschmiede und Edelsteinschleifer schillernde Mosaike mit Darstellungen der Hauptgottheiten – wie dem mit rituellen Kämpfen assoziierten Moche-Vogel in Menschengestalt. Zum Erfassen der statistischen Daten, die man für die zentralistische Verwaltung des riesigen Inka-Reiches benötigte, verwendeten die Inka ihre geheimnisvolle ‚Knoten-Schrift‘ Quipu. Statt einer Schrift im engeren Sinne, benutzten sie ein System von Knotenschnüren. Ein Quipu besteht aus einer horizontal gehaltenen Schnur, an der viele Seitenschnüre befestigt sind. Für Kundige beinhalteten diese Knoten eine Vielzahl von Informationen. So regelten die Inka beispielsweise ihre Steuern über Knotenschnüre. Es gab aber auch Qipus, die Geschichten und historische Ereignisse erzählten. Die Quipus sind immer noch ein Rätsel - bis heute konnten sie nicht entziffert werden. Zwar wurden sie bis 1583 vor Gericht als Beweismittel akzeptiert und es gibt Dokumente der Kolonialzeit, die diese Quipus in Schriftsprache übersetzen. Allerdings sind die dazugehörigen Knotenschnüre nicht mehr erhalten. Und so warten die Quipus bis heute auf ihren ‚Stein von Rosetta‘ – auf einen Vergleichstext, der die Knotenschrift entziffern könnte. 1583 wurden die Knotenschnüre der Inka von den Spaniern zerstört. Einer der wenigen Quipus, die trotzdem erhalten blieben, ist in der Ausstellung zu sehen. Die Inka waren eine Weltmacht ihrer Zeit. Und doch wurden sie von 172 spanischen Conquistadores besiegt, die Pferde, Kanonen und Krankheiten in das Land brachten. Mit dem Tod des Inka Atahualpa 1533 war das sagenhafte Inka-Reich Vergangenheit. Der Mythos der Inka aber lebt – bis heute. |
|
[kol_3] Sehen: Schwarzwalddörfer im Dschungel
Zé do Rock ist ein in Stuttgart lebender Kabarettist und Schriftsteller mit brasilianischen Wurzeln. Der Film macht sich gemeinsam mit ihm auf die Suche nach deutschen Abenteurern in Südamerika. Zé do Rock führt zu Menschen aus dem Südwesten, die in Brasilien ihr Glück gefunden haben.
Sendetermin und Hintergrundinfo Sonntag, 18. Juni 2017 | 20:15 (SWR) Schwarzwalddörfer im Dschungel Auswanderer - Vom Südwesten nach Südamerika Film von Lourdes Picareta Du findest den Film nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek.
Eine Entdeckungstour führt in den brasilianischen Regenwald und dort zu zwei Mainzer Urwaldforschern. Weiter geht es auf einer Reise quer durch Brasilien zu Stuttgartern im Karneval von Salvador do Bahia und einem Bäcker aus Worms in São Paulo. Außerdem zu der Schwarzwald-Kolonie Colonia Tovar in Venezuela und zu deutschen Auswanderern, die am Fuß eines chilenischen Schneevulkans leben. Die Reise mit Zé do Rock endet in Porto Alegre, dessen Heimatstadt.
Text: SWR [druckversion ed 06/2017] / [druckversion artikel] |
|
[kol_4] Lauschrausch: Songs of struggle & hope (Agustín Lira)
Durch die Wahl Donald DUMPs zum 45. US-Präsidenten gewinnt dieses Album mit Protestliedern enorm an Aktualität. Agustín Lira, in Mexiko geboren, aber im Alter von sieben Jahren aus ökonomischen Gründen mit seinen Eltern nach Kalifornien gezogen, entwickelte schnell ein Gespür für die Ungerechtigkeit gegenüber seinen Landsleuten. Mit 19 gründete er 1965 während eines Landarbeiterstreiks mit seinen Brüdern "El Teatro Campesino", das sich zu einem wichtigen Sprachrohr der chicano-Bewegung entwickelte. Auf Tiefladern spielten sie Theater und sangen sozialkritische Lieder. Nach seinem Ausstieg, 1969, blieb er der Musik treu, u.a. mit seiner Gruppe Alma. "Songs of struggle & hope" präsentiert einen Querschnitt seines Schaffens, Lieder, die musikalisch auf mexikanischer Folklore wie der ranchera oder dem huapango basieren, vermischt mit angelsächsischer Folkmusik, und die sich als Stimme der Benachteiligten verstehen: Schon im ersten Song erklärt er, warum ein Mexikaner kein Gringo sein kann: im Körper trägt er das Blut der Zapoteken etc., den Geist von Cautemoc, Pancho Villa etc., um dann ein trauriges Lied über Immigration („yo me voy al otro lado, donde no hay revolución"), anzustimmen. Er besingt das Leid der indigenen Bevölkerung ("El indio"), mexikanische Volkshelden – Juan Cortina, Gregorio Cortez -, die auf eigene Rechnung gegen die USA kämpften (und auch für ihr Vermögen!), unterstützt die zapatistischen Aufstände, die ab 1992 Mexiko erschütterten ("Los zapatistas"), und widmet seiner Partnerin und Mitmusikerin Patricia Wells zwei Liebeslieder auf Englisch. In dieser Sprache wendet er sich gegen willkürliche Enteignungen in Fresno ("If you’re homeless") und singt das für mich originellste Lied der Sammlung: "Taps for Coke", ein fröhliches Anti-Coca-Cola-Lied über die Verfehlungen dieses Konzerns ("Coke, coke you give us no hope!"). Eines der ersten Lieder, die Lira schrieb (Ser como el aire libre"), im Rhythmus des huapango, handelt von der Forderung nach Freiheit und Gleichheit für alle Menschen, die sich als roter Faden durch dieses hörenswerte Album mit umfangreichen, zweisprachigem Booklet zieht. Cover: amazon [druckversion ed 06/2017] / [druckversion artikel] / [archiv: lauschrausch] |
.