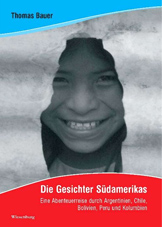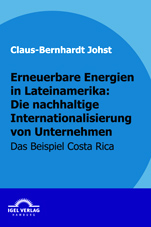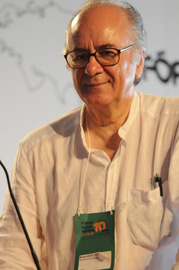ed 02/2010 : caiman.de
kultur- und reisemagazin für lateinamerika, spanien, portugal : [aktuelle ausgabe] / [startseite] / [forum] / [archiv]
|
brasilien: Rios Polizei befriedet die Vorzeigeviertel
THOMAS MILZ |
[art. 1] | druckversion: [gesamte ausgabe]  |
|
|
argentinien: Die Gesichter Südamerikas (Buchauszug III)
"Gipfelsturm" auf sechstausend Meter Höhe THOMAS BAUER |
[art. 2] | ||
|
bolivien: Auf den Spuren Che Guevaras und Bruce Chatwins
Teil IV: Häusermeere und Ein Tango und drei U's LENNART PYRITZ |
[art. 3] | ||
|
spanien: La Retirada 1939/40 – Rückzug, Flucht und Internierung
WOLFGANG HÄNISCH |
[art. 4] | ||
|
argentinien: Im Kaffeehaus
ANDREAS DAUERER |
[art. 5] | ||
|
costa rica: Wie wichtig ist die Rolle Costa Ricas für das Weltklima?
CLAUS-BERNHARDT JOHST |
[art. 6] | ||
|
lateinamerika: 200 Jahre Befreiung
Kontinent der Hoffnung – Interview mit Walther L. Bernecker TORSTEN EßER |
[art. 7] | ||
|
brasilien: Stimmen aus der Gegenwelt
Das 10. Weltsozialforum in Porto Alegre THOMAS MILZ |
[art. 8] |
|
[art_1] Brasilien: Rios Polizei befriedet die Vorzeigeviertel
In Rio de Janeiros Postkartenmotiv ist endlich Ruhe eingekehrt. Ende letzter Woche hat die Polizei den letzten Favela im Stadtviertel Copacabana mit einer Einheit der Befriedungspolizei besetzt, der so genannten UPPs, Unidade de Policia Pacificadora. Die Drogenbanden seien vertrieben worden, so die Regierenden, die nicht noch einmal einen solchen Imageschaden für die Olympia-Stadt 2016 riskieren wollen wie im Oktober 2009 als Kriminelle einen Polizeihubschrauber vom Himmel schossen. Nur wenige Tage nach der Entscheidung der Vergabe der Olympischen Spiele wurden damals bei Gefechten zwischen Drogenbanden und der Polizei mehr als 50 Menschen getötet. Die Reaktionen der Weltpresse zeigten den Regierenden der Stadt, dass das Vertrauen in die Sicherheit der Fußball-WM 2014 und der Olympischen Spiele 2016 erschüttert war. Gouverneur Sergio Cabral reagierte mit dem Einsatz einer Spezialtruppe der Polizei, die Ende letzten Jahres damit begann, die Favelas rund um die weltberühmte Südzone der Stadt zu besetzen. Das erklärte Ziel der Aktion sei dabei die Bekämpfung des Drogenhandels und die Vermeidung bewaffneter Konflikte, so Cabral.
Letzte Woche wurde mit der Befriedungsaktion in den Favelas Morro dos Cabritos und Ladeira dos Tabajaras die letzten der Favelas an den Hügeln der Copacabana besetzt. Dabei geht die Polizei neue Wege und organisiert die Besetzung gemeinsam mit den Vertretern der Anwohner und ohne die in der Vergangenheit eingesetzten schweren Waffen. Lediglich mit ihren Dienstpistolen bewaffnet patrouillieren die Polizisten nun in den Favelas. Zudem stehen den meisten UPPs weibliche Polizisten vor, eine Vertrauen schaffende Geste gegenüber den Bewohnern. Vorbei sein sollen die Zeiten als man die Armee mit ihren schweren Panzern in den Favelas aufmarschieren ließ um den Drogenbanden die Stirn zu bieten. Die Strategie scheint aufzugehen. Die Bewohner vertrauen den Sicherheitskräften und heißen deren Präsenz willkommen, so Claudio Carvalho, Präsident der Anwohnervereinigung der Favelas Morro dos Cabritos und Ladeira dos Tabajaras. Eine Einschätzung die auch die Polizei und die Regierenden teilen. Dazu tragen die mit der Besetzung durch die Polizei eingeleiteten Verbesserungen der Infrastruktur in den ungeordnet errichteten Häuserkomplexen hoch über der Stadt bei.
Neben den 120 Polizisten, die in der Favela Ladeira dos Tabajaras ihren Dienst tun, sieht man überall Arbeiter Stromkabel verlegen und Wege ausbessern. Nach Jahrzehnten der Nichtbeachtung scheinen die Menschen hier nun endlich in der Stadtgemeinschaft angekommen zu sein. "Wir leben jetzt in Frieden", fasst Carvalho die Situation zusammen. Die Drogenhändler des Comando Vermelho (Rotes Kommando), die bis vor wenigen Wochen die Favelas in der Copacabana in Händen hielten, haben sich in andere Gebiete der Stadt abgesetzt, hoch an den Nordrand der Stadt, wo die Befriedungspolitik von Gouverneur Cabral noch nicht angekommen ist. Aber auch hier soll demnächst gehandelt werden. "Im April werden 1.300 neue Rekruten eingestellt – mehr als derzeit in allen UPPs zusammen. Und im Juni kommen noch einmal 2.000 Mann hinzu", verspricht der Gouverneur. Neben den sechs Favelas der Copacabana hat die Polizei bereits weitere UPPs in anderen Favelas der Stadt eingerichtet: in der Dona Marta in Botafogo, dem Jardim Batam in der Westzone und in der Cidade de Deus, berühmt gewordenen durch den Film "City of God" – "Stadt Gottes" in Rios Norden. Insgesamt 160.000 Favelabewohner stehen so unter dem Schutz der UPPs. Mit den dieses Jahr noch dazu kommenden Polizeikräften soll diese Zahl auf über 300.000 ansteigen. Bisher habe die Polizei lediglich in relativ friedlichen Favelas UPPs eingerichtet und es bleibe abzuwarten, ob sich die riesigen Favelakomplexe im Norden der Stadt ebenso leicht befrieden lassen, wie die kleinen der Südzone, warnen Kritiker. So hätten sich viele bewaffnete Banden aus der Südzone zurückgezogen und dafür die Bastionen des Comando Vermelho in Favelas wie dem Complexo do Alemão und der Favela da Mare im Norden verstärkt. Dort, fernab der Traumstrände, der Touristen und der Sportstätten müsse die Regierung zeigen, ob sie die neue Befriedungspolitik wirklich ernst nehme. Immerhin habe der Staat in den Favelas bisher stets durch Abwesenheit geglänzt.  Claudio Carvalho ist sich sicher, dass die neue Polizeistrategie mit den kommenden sportlichen Großereignissen zusammenhängt. "Früher kam die Polizei nur hierher um jemanden festzunehmen und die Banden zu bekämpfen. Doch jetzt wollen sie das Feld bereinigen, damit Ruhe herrscht, wenn die Spiele beginnen." Über die Drogenbanden enthält er sich jeglichen Kommentars. Man könne ja schließlich nicht wissen, ob Gouverneur Cabral wiedergewählt werde oder aber seine Politik ändere und die Polizei wieder abziehe. Denn dann werden die Drogenbanden schnell wieder die Macht übernehmen. Die Polizei mag schon in den Favelas angekommen sein, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Politiker ist es jedenfalls noch nicht. Text: Thomas Milz Fotos: Roberto Cattani [druckversion ed 02/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: brasilien] |
| [art_2] Argentinien: Die Gesichter Südamerikas (Buchauszug III) "Gipfelsturm" auf sechstausend Meter Höhe Am Tag nach meinem Gleitschirmflug und dem gemeinsamen "Abend" mit Natalia, Sabrina und Vidal unternahm ich etwas, das meinen weiteren Aufenthalt in Mendoza entscheidend prägen sollte. Ich ging in die örtliche Buchhandlung und holte mir den Abenteuerbericht eines Bergsteigers, der unter anderem den Aconcagua bezwungen hatte. Im Allgemeinen las ich Bergsteigerbücher nicht besonders gern, weil diese meistens mit einem Satz anfingen, der in etwa so lautete: "Unerbittlich brannte die Sonne vom Himmel, doch der schneebedeckte Gipfel erhob sich klar und verheißungsvoll vor unseren Augen". Nicht selten ging es danach in einem tagebuchähnlichen Stil weiter, in dem inhaltsleere Floskeln wie "Tag eins" vorkamen. Das gekaufte Buch enthielt jedoch dermaßen gelungene Bilder von Andengipfeln, dass es mir geradezu skandalös vorkam, nicht zu versuchen, einen der Riesen näher kennenzulernen. Noch am selben Tag buchte ich einen siebentägigen Gipfelsturm bei Pedro, einem weit über Mendoza hinaus bekannten Bergführer. Außer mir würden vier Offiziere der israelischen Armee dabei sein, die sich auf einer einjährigen Weltreise befanden. Vidal machte sich nichts aus Bergen; er reiste stattdessen weiter Richtung Bolivien. Am nächsten Morgen wollte mich Pedro von der Jugendherberge abholen und zu einer Berghütte auf zweieinhalbtausend Metern Höhe bringen. Ein Hochplateau namens Rincón del Plata, "Silberstrahl" also, auf etwa sechstausend Metern Höhe sollte von dort an sechs Tage lang das Ziel all unserer Anstrengungen sein.
Vor unserem Aufbruch hatte mich Pedro gefragt, ob ich genügend Ausrüstung für unser bevorstehendes Abenteuer dabei hätte. Klar habe ich die, hatte ich geantwortet, ich habe einen dicken Anorak dabei, zudem Schal und Mütze und neue Bergstiefel. Wie es mit einem langärmligen Unterziehhemd aus Kunstfasern aussähe, wollte Pedro wissen, ob ich an Spikes gedacht hätte, mit denen ich auf den Eisfeldern entlanglaufen konnte und zudem an Skistöcke, zwei Spezialpullover, eine windabweisende Überziehhose, eine extradunkle Sonnenbrille, ein Taschenmesser, eine Stirnlampe und zwei wintererprobte Fäustlinge. Als ich all dies verneinte, schrieb mir Pedro die Adresse eines Sportgeschäfts auf einen Zettel und gab mir auf, morgen früh mitsamt den genannten Sachen parat zu stehen. Die Ausrüstung könne ich von dort ausleihen. Am nächsten Tag begann mein einwöchiges Abenteuer. Tag eins: Aufstieg zum Zwischenlager Unerbittlich brannte die Sonne vom Himmel, doch der schneebedeckte Gipfel erhob sich klar und verheißungsvoll vor unseren Augen. Fast unerreichbar erschien er uns, wie der weithin sichtbare Repräsentant einer anderen Welt, in der es weder Pflanzen noch Tiere gab und die Böden ganzjährig von meterdickem Eis und Schnee bedeckt waren. Sobald die Sonne abends verschwand, herrschten dort oben Bedingungen, in denen man nur überlebte, wenn man die richtigen Vorkehrungen getroffen hatte und sich an die Spielregeln hielt, die man nicht ändern, sondern nur befolgen konnte. Im Zickzack schraubten wir uns von der Bergsteigerhütte auf eine dreitausendachthundert Meter hoch gelegene, von Felsbrocken übersäte Ebene hinauf, wo wir Schutz vor den nächtlichen Winden finden wollten. Während des Aufstiegs ließen wir ausgedehnte Wiesen zurück, balancierten an Steilhängen entlang und kreuzten glasklare Bergflüsse, an denen wir unsere Wasserflaschen auffüllten. "Macht die Flaschen bloß nicht ganz voll", mahnte Pedro, "sie zerspringen sonst nachts durch den Frost!". "Wenn Ihr in dem Tempo weitermacht, werdet Ihr mich auf den Gipfel tragen müssen", lobte unser Bergführer kurz darauf, als wir gegen fünf Uhr abends um zwei Gaskocher herumsaßen, auf denen eine immense Menge Spaghetti mit Tomatensoße köchelte. Zwei Stunden später begannen die Berge um uns herum, vom Licht der untergehenden Sonne bepinselt, kupferrot zu leuchten. Der Name "Anden" geht auf eben diese Erscheinung zurück, die hier, entlang der längsten Bergkette der Welt, intensiver zum Ausdruck kommt als anderswo: Das Quechuawort "Anta" bedeutet übersetzt soviel wie "Kupfer". Da es für die vier israelischen Offiziere und mich das erste Mal war, dass wir uns in derartige Höhen empor wagten, waren wir voller Spannung. Bedenken hatte niemand von uns, was die These unterstreicht, dass die Furcht eine vollkommen irrationale Angelegenheit ist. Durch alle Bevölkerungsgruppen und Schichten hindurch gilt wohl das Paradox, dass derjenige am meisten Angst hat, der am wenigsten gefährdet ist. Nehmen wir eine alte Dame, die in ihrem Sofasessel sitzt, in einem bayerischen Städtchen, einer Region also, in der die Erdbebenwahrscheinlichkeit gegen Null tendiert, in der die Gefahr eines Vulkanausbruchs nicht existiert und ein gewalttätiger Putschversuch äußerst unwahrscheinlich ist. Rundherum leben Menschen, die ein regelmäßiges Einkommen beziehen. Auf den Straßen ereignen sich kaum Überfälle; auch Erdrutsche sind äußerst selten. Es gibt weder Giftschlangen noch Skorpione, keinen Typhus, keine Malaria, keine Hepatitis, und die Gefahr, durch verseuchtes Trinkwasser dahingerafft zu werden, ist verschwindend gering. Sollte trotz alledem etwas passieren, ist in der Regel ein Arzt in der Nähe. An die Polizei kann man sich wenden, ohne Sorge zu laufen, erpresst, verhaftet oder niedergeschlagen zu werden. Ein junger Mann aus Kolumbien hat all diese Sicherheiten nicht. Warum also ängstigt sich die alte Dame vor Einbrechern und schenkt Schlagzeilen Glauben, die von einer "Zunahme der Jugendkriminalität" berichten? Und warum sucht der junge Mann zusätzlich nach Abenteuern, indem er zum Beispiel an Demonstrationen teilnimmt, die zumeist in einer Schlagorgie der Polizei enden? Die Antwort darauf kann nur zum Teil darauf zurückgeführt werden, dass sich die alte Frau schwach und der junge Mann stark fühlt. Und dass die Vorstellung, was passieren könnte, größere Ängste erzeugt als reelle Gefahren. Der andere Teil der Antwort hängt damit zusammen, dass wir in Europa, verglichen mit beinahe dem gesamten Rest der Welt, in einer Wohlstandsblase leben und Angst haben, Dinge zu verlieren, die uns unentbehrlich erscheinen, während Andere diese Dinge erst gar nicht erreichen werden. Von einigen dieser Dinge musste ich mich auf meiner Reise verabschieden – in den kommenden sieben Tagen beispielsweise von einer angenehmen Schlafmöglichkeit. Die erste Nacht verbrachte ich, eingehüllt in zwei Pullover und meinen Schlafsack, in einem tarnfarbenen, drei Meter breiten Zelt der israelischen Armee. Neben mir schnarchten Pepe und Marlboro, zwei junge Offiziere, die heute ständig von Panzermanövern, absurden Mutproben im Palästinensergebiet und der Bedienung vollautomatischer Waffen gesprochen hatten. Alles in allem befand ich mich in einer Situation, in die ein Deutscher höchst selten gelangen dürfte.
Tag zwei: Israel gegen die Welt Am zweiten Tag bekam ich Gelegenheit, meine vier Mitstreiter näher kennenzulernen. Während wir vom Lagerplatz hinunter auf dreitausend Meter wanderten und uns anschließend auf viertausenddreihundert Meter empor kämpften, um uns langsam an immer extremere Höhen zu gewöhnen, unterhielten sich die vier zwar noch immer weitestgehend über Militärtaktiken und zurückliegende Heldentaten, gaben jedoch darüber hinaus bereitwillig Auskunft, wenn ich sie direkt nach bestimmten Dingen fragte. "To prove that I can make it", sagte Pepe beispielsweise, als ich ihn fragte, warum er auf den Gipfel wollte. Alle vier waren in den Zwanzigern, abgehärtet durch wochenlanges Wüstentraining, durchtrainiert dank regelmäßiger morgendlicher Appelle um vier Uhr und dadurch, dass sie permanent beweisen mussten, dass sie mehr konnten als alles, was man ihnen zutraute. Während sich die anderen drei, allen voran Pepe, eher einen Arm abhacken würden, als vor dem Gipfel umzudrehen, sah Marlboro die Sache etwas gelassener. Seinen Spitznamen hatte er von uns erhalten, weil er es sich nicht nehmen ließ, sich auch auf viertausend Metern Höhe eine Zigarette anzuzünden.Meine vier Mitbergsteiger hatten eine erstaunliche Bandbreite zu bieten, wenn es darum ging, wen sie warum nicht mochten. "Deutsche mögen wir nicht besonders und Franzosen können wir nicht ausstehen", betonte Pepe. Er mochte auch Russen, Chinesen, Japaner und Kanadier nicht, weil die allesamt pro-arabisch eingestellt seien. Nur die USA würden sich manchmal für Israel stark machen – vor allem, wenn gerade ein neuer Präsident gewählt würde. Als ich Pepe fragte, wen er in diesem ganzen Durcheinander am meisten hasste, antwortete er mit tiefer Stimme: "Arabs", und ich wusste, dass er es ernst meinte. Aus seinem Mund klang dieses Wort wie eine Seuche, was mich sofort gegen ihn aufbrachte. In arabischen Ländern wie der Türkei sei ich mit bedingungsloser Gastfreundschaft empfangen worden, wohingegen ich nicht verstand, wie eine demokratisch gewählte Regierung wie die israelische Morde an ausländischen Führern in Auftrag geben könne, gab ich mich kämpferisch, doch Pepe winkte ab. "Ich will wirklich niemanden beleidigen", sagte er langsam, "aber Außenstehende können unsere Lage nicht begreifen. Jeden Tag, jede Sekunde, kann bei uns die nächste Bombe hochgehen. Vielleicht passiert es in dem Café, in dem du sitzt oder in dem Bus, in den du steigst. Wir sind umgeben von Feinden, die öffentlich verkünden, uns "ins Meer jagen" zu wollen. Wenn du von allen um dich herum gehasst wirst, beginnst du selbst ebenfalls zu hassen – und zu begreifen, dass du nur überlebst, wenn du stärker als die Anderen bist." "Überleben" gehörte zu Pepes Lieblingsvokabeln, ebenso wie "hart", "Kriegslogik" und "Panzerabwehrrakete". Auch wenn mir manches von dem, was er sagte, einseitig vorkam und ich einiges auf seinen jugendlichen Eifer zurückführte, wusste ich, dass er in einem Punkt Recht hatte: Ich kam aus einer völlig anderen Welt, in der ich nicht gegen die Hitze und Trockenheit von Wüsten ankämpfen musste und in meine Nachbarländer reisen konnte, ohne als Mörder beschimpft und verjagt zu werden. Vielleicht, so dachte ich am Ende dieses zweiten Tages, vielleicht war Pepes Furcht vor Bombenanschlägen, Raketentreffern und Selbstmordattentätern wirklich nicht sonderlich übertrieben. Denn auch wenn er es sich niemals eingestehen würde, so war es letztlich doch Furcht, die ihn zu seinen extremen Aussagen trieb. Tag drei bis fünfeinhalb: Das Basiscamp Auch am heutigen Tag scheuchte uns Pedro talwärts, hinunter auf dreitausendneunhundert Meter, ehe wir kehrt machten und Tausend Höhenmeter überwanden, um das zentrale Basiscamp zu erreichen. Hier würden wir die kommenden drei Nächte verbringen. Besser gesagt die kommenden zweieinhalb Nächte, denn um drei Uhr in der Früh würde unser eigentlicher Gipfelsturm beginnen. Das Basiscamp war ein seltsamer Ort, der eigentlich nur eingerichtet worden war, um andere Orte erreichen zu können. Niemand wollte hier sein, dennoch verbrachten fast alle Bergsteiger die meiste Zeit im Basiscamp. Als uns Pedro am vierten Tag aufgab, möglichst viel herumzulaufen, ohne uns dabei allzu sehr anzustrengen, wurde mir klar, dass die meisten Bergsteigergeschichten darum so spektakulär klangen, weil die jeweiligen Wartezeiten ausgelassen wurden. Wir "Frischlinge" verbrachten zwei volle Tage ausschließlich mit Warten. Währenddessen überquerten wir probeweise erste Schneefelder, tranken täglich fünf Liter Tee, aßen kohlenhydratreiche Nudelgerichte und plauderten mit unseren Nachbarn. Eine belgische Bergsteigergruppe hatte ihre Zelte direkt neben den unseren aufgeschlagen. Weiter hinten lagerte ein brasilianischer Alleingänger, der im vergangenen Jahr am Aconcagua gescheitert war und es dieses Jahr erneut versuchen wollte. Es folgten zwei Extrembergsteiger aus den USA, die bereits drei Sechstausender hinter sich hatten und "just for fun" einen weiteren "mitnehmen" wollten, und schließlich eine Dreiergruppe aus Argentinien, die wie wir zum ersten Mal in derartigen Höhen unterwegs war.
Das Basiscamp war eine Begegnungsstätte für raumergreifende Egos. Denn nicht um schöne Ausblicke, interessante Begegnungen, einmalige Erkenntnisse ging es in den Gesprächen, sondern um zurückgelegte Höhenmeter, Zeiten bis zum Gipfel und Fachsimpeleien, die den optimalen Abstand der Spikes oder die ideale Mischung von Kunstfaser und Baumwolle bei den Handschuhen betrafen. Die beiden amerikanischen Extrembergsteiger ließen es sich nicht nehmen, bei minus zehn Grad Celsius in Shorts und lässig übergeworfenen Pullovern herumzulaufen. Eine junge Frau gab achtmal bekannt, dass sie gestern lediglich sechs Stunden bis zum Gipfel eines Sechstausenders benötigt habe. Pedro sah die Dinge ein klein wenig anders. Am Abend des fünften Tages, unserem letzten vor dem entscheidenden Aufbruch, nahm er uns bei je einem halben Kilogramm Tagliatelle und zwei Litern Tee ins Gebet. "In weniger als sechs Stunden werden wir zu einem Gewaltmarsch aufbrechen, der euch an die Grenze eurer Leistungsfähigkeit bringen wird. Um zwölf Uhr mittags müssen wir auf dem Gipfel stehen. Selbst zu dieser Tageszeit werden es da oben minus dreißig Grad sein. Sollten Winde aufkommen, werden wir sofort kehrtmachen, weil wir auf sechstausend Metern nicht die Kraft haben, uns gegen sie zu stemmen. Versucht am besten, gleich zu schlafen. Um zwei Uhr nachts werde ich Euch wecken, damit wir pünktlich um drei loskommen." In dieser Nacht, bekleidet mit allem, was ich hatte, in einem israelischen Armeezelt, höher als alles, was in Europa existiert, schlief ich unruhig. Traumfetzen huschten durch meine Gedanken, entwarfen Bilder von Geröllfeldern, Schneelawinen und abstrusen Bergwesen. Dreimal wachte ich auf, weil Füchse auf der Suche nach Essbarem unser Lager ausfindig gemacht hatten, Töpfe und Tassen umwarfen und sich lautstark um ein Stück Abfall stritten. In der Ferne schrie ein Guanako hell auf. Ich war in der Wildnis angekommen und noch in dieser Nacht würde ich tiefer und tiefer in diese Wildnis eindringen. Immer höher würde ich mich schrauben, immer weiter hinein in ein unwirtliches, lebensfeindliches Gebiet.
Tag sechs: Der "Gipfelsturm" Um zwei Uhr blitzte der Schein von Pedros Taschenlampe in unser Zelt. Vamos, flüsterte er, um die Schläfer um uns herum nicht zu wecken. Ich schlüpfte aus dem Schlafsack, prüfte den Sitz meiner Überziehhose, machte den extradicken Anorak über meinem T-Shirt, dem Langarmhemd und den beiden Pullovern zu, stopfte drei Liter Wasser in meinen Rucksack, verteilte zwei Schichten Sonnencreme auf meinem Gesicht und umfasste meine Skistöcke mit den Fäustlingen. Kurz darauf führte uns Pedro in die Nacht hinaus. Unser Gipfelsturm hatte begonnen. Bereits nach wenigen Metern wurde mir klar, dass "Gipfelsturm" ein Wort war, das jeder Berechtigung entbehrte. Pedro ermahnte uns ständig, kleine Schritte zu machen und langsam zu gehen, sonst hätten wir oben keine Puste mehr. Um uns herum war es stockdunkel, und ich erkannte nur den Schein von Pedros Stirnlampe vor mir, der rhythmisch hin und her schwang. Hinter mir folgten die vier Israelis. Nach einer knappen Stunde hörten wir unvermittelt rechts von uns ein Geräusch, das ich bislang nur von Baustellen kannte, wenn ein großer Laster tonnenweise Schutt auf den Boden entlädt. Sofort blieben wir alle bis auf Pedro stehen und starrten wie gebannt in die Nacht hinein. Erkennen konnten wir nicht das Geringste, dazu waren unsere Stirnlampen zu schwach. Doch es kam uns vor, als habe uns das Gebirge gerade zwei Minuten lang angeknurrt. "Kommt Ihr?", rief Pedro zu uns hinab. "Keine Sorge, das war nur eine Gerölllawine". In diesem Tonfall hätte er auch sagen können, dass es sich um ein Wölkchen gehandelt habe. Wir jedoch waren noch immer tief beeindruckt. "Sag mal, Pedro, sind diese Lawinen nicht gefährlich oder so?", fasste sich schließlich Marlboro ein Herz, als wir zu Pedro aufgeschlossen hatten. "Natürlich sind sie das!", gab dieser zurück, "aber nur, wenn man die Berge nicht kennt. Solange Ihr dicht hinter mir bleibt, wird Euch nichts passieren." Gleichmäßig wie ein Uhrwerk stapfte Pedro vor uns her, kontrolliert setzte er einen Fuß vor den anderen. Wir versuchten, es ihm gleichzutun. Als sich die Nacht gegen sechs Uhr morgens zurückzog, waren wir auf einer Höhe von fünfeinhalbtausend Metern angekommen. Hier erst gönnte uns Pedro eine erste Pause. Obwohl sein Thermometer minus zwanzig Grad Celsius anzeigte, waren wir alle in den vergangenen Stunden ins Schwitzen gekommen. Das änderte sich augenblicklich, als wir uns auf den Boden setzten, um Wasser zu trinken und die mitgebrachten Karamellbonbons zu lutschen. Nach zwei Minuten kroch die Kälte in unsere Körper. Eine Minute später stand Pedro auf. "Es ist ein bisschen gemein", gab er zu, "doch hier oben können wir keine längeren Pausen machen. Die Umstände sind bereits jetzt zu extrem." Fünfhundert Höhenmeter fehlten uns noch bis zum Gipfel. Fünfhundert Höhenmeter in sechs Stunden, das wäre in den Alpen ein beschaulicher Ausflug mit Zeit für mehrere Vesperpausen. Doch das hier waren nicht die Alpen. Das hier waren die Alpen hoch drei. Schon beim Aufstehen spürten wir, dass etwas anders geworden war. Mühsam warf ich mir den Rucksack über und nahm meine Position hinter Pedro ein. Hinter mir war Marlboro ins Keuchen gekommen. Aus den Augenwinkeln erkannte ich, dass der Tag begann, ein atemberaubendes Panorama um uns herum zu zeichnen. Vor uns erhoben sich die Berge des Rincón del Plata, während es keine fünf Schritte zu unserer Linken zweitausend Meter senkrecht bergab ging. Da erst merkte ich, dass wir bisher auf einem Höhenrücken entlanggelaufen waren. Pedro hatte Recht gehabt: Hier hätten uns keine Lawinen überraschen können. Allerdings hätten wir keine Schritte außerhalb des kleinen Pfades unternehmen dürfen, weil nicht zu erkennen gewesen war, wo genau das Schneefeld zu Ende war und der Abgrund begann. Der Boden hielt mich fest. Er zerrte an meinen Beinen und wollte mich nicht weiterlassen. Als versuchte der Rincón del Plata, uns mit aller Kraft von sich fernzuhalten. Ich fühlte mich zweihundert Kilogramm schwer und keuchte bei jedem Schritt. Meinen Mitstreitern erging es nicht besser. Sogar Pedro atmete heftig. Sein Gesicht wirkte verkrampft, wenn er sich zu uns umdrehte, um nachzusehen, ob wir alle mitkamen. Wir hatten mittlerweile die typische Gangart in extremen Höhen angenommen. Behäbig schoben wir den linken Fuß vor den rechten, setzten ihn fest auf den Boden und verharrten eine Sekunde lang in dieser Position, bevor wir kontrolliert den rechten Fuß anhoben und vor den linken setzten, um wieder eine Sekunde zu verharren. Quälend langsam kamen wir auf diese Weise voran. Meter erschienen uns wie Kilometer, doch nur so hatten wir eine Chance, unsere Energie bis zuletzt aufzusparen. Wir keuchten und japsten wie alte Dampfloks. Unser Ziel erschien indessen zum Greifen nah: Direkt vor uns erhob sich der Rincón del Plata, als blicke er triumphierend auf uns herab. Trotzdem kamen wir dem Gipfel kaum näher. Nach weiteren drei Stunden waren wir auf fünftausendachthundert Metern angekommen und Pedro verordnete uns die nächste Minipause. Als ich drei Minuten später aufstehen wollte, drückte mich etwas mit voller Kraft gegen den Boden. Zeitgleich erwachte ein Männchen in meinem Kopf. Wie wild sprang es hin und her, klopfte immer wieder von innen gegen meine Schädeldecke. Währenddessen pumpte mein Herz wütend Blut durch meinen Körper. Es sah nicht ein, warum es sich so anstrengen musste. Auch die Luftröhre nahm es mir übel, dass ich sie so sehr unter Druck setzte, zumal bei meinen hechelnden Atemzügen zu wenig Sauerstoff mitkam. Zeitgleich gab mein Gehirn den Befehl aus, sich endlich in Bewegung zu setzen. Ächzend stand ich auf, während mir Pedro durch wabernde akustische Schleier hindurch mitteilte, dass es von nun an keine Pause mehr geben dürfe. Als ich den ersten Schritt machen wollte, um Pedro zu folgen, schienen meine Schuhe aus massivem Eisen zu bestehen, während ich über einen riesigen Magneten lief. Das Männchen in meinem Kopf schlug Purzelbäume und hämmerte mit aller Kraft an die Wände seines Gefängnisses. Dann löste sich die mir bekannte Welt Schritt für Schritt auf. Es begann damit, dass Pedro sich zu uns umdrehte und etwas wie "Nur noch hundert Höhenmeter" murmelte. Ich konnte ihn nicht genau verstehen, weil seine Stimme von dichten Nebeln umgeben war. Noch während ich mir überlegte, ihm zu sagen, er möge doch bitte deutlicher sprechen, sah ich, wie er sich vom schneebedeckten Boden löste. Schließlich schwebte er engelsgleich etwa zwanzig Zentimeter über der Erde vor uns her. Sein Verhalten kam mir wunderlich vor, doch als ich mich umdrehte merkte ich, dass auch Pepe über dem Boden schwebte. Ich wollte ihm erklären, dass ihm das ja wohl ungerechtfertigte Vorteile verschaffte und er gefälligst wieder herunterkommen sollte, brachte aber keinen Ton heraus. Zudem bereitete mir Marlboro größere Sorgen, weil er hin und her wankte wie ein Schiffsmast bei starker See. "Ahoi Käpt’n!", rief er mir grinsend zu, "volle Kraft voraus!" Dann stimmte er ein altes Piratenlied an, in dem es um schöne Jungfrauen und Buddeln voller Rum ging. Ein Bergfuchs kam links von uns die Steilwand emporgesegelt und ließ direkt neben mir ein lang gezogenes Heulen hören, bevor er weiter zum Gipfel schwebte. Auch das konnte ich nicht als regulär durchgeführten Gipfelsturm gelten lassen. Ich wunderte mich, wie schnell der Nebel hier oben dichter wurde. Kaum konnte ich die eigene Hand vor Augen sehen. Dennoch erschien mir alles, was ich durch diesen Nebel hindurch sah, vollkommen real – bis mir unvermittelt Vidal auf die Schulter klopfte. Auch er schwebte zwanzig Zentimeter über dem Boden, doch das schien hier oben keine Seltenheit mehr zu sein. "It’s magic!", lachte er und deutete theatralisch mit dem rechten Arm auf das Bergmassiv vor mir. Leider hörte er nicht auf, mir auf die Schulter und den Hinterkopf zu klopfen. Als ich seine Hand unwirsch wegwischen wollte, erschien plötzlich Pedros Gesicht direkt vor mir. "Tomás, hombre, wir haben es geschafft! Willkommen auf dem Rincón del Plata. Sechstausend Meter unter uns liegt der Pazifik. Was sagst Du dazu?" Was sagte ich dazu? Was sagt man, wenn man eben von einem fliegenden Bergfuchs auf dem Weg zum Gipfel überholt worden ist und ein Zauberer, der sich eigentlich fünftausend Meter tiefer befinden sollte, einem anerkennend auf die Schulter klopft? Ungeheuer müde blickte ich um mich, ließ die Aussicht auf die mächtige Flanke des Aconcagua in meine Augen gleiten. Direkt dahinter begann bereits Chile. Wenige Menschen waren jemals so hoch gekommen wie ich. "Wie schön!", fasste ich meine Eindrücke zusammen und verteilte, völlig unpassend zur eben getroffenen Aussage, die Hälfte des gestrigen Abendessens auf dem Gletscherfeld. Mein Magen rotierte heftig um die eigene Achse. Mein Herz schickte Wellen aus Blut den Hals hinauf.
Sich auf sechstausend Metern zu übergeben war in etwa das, was Pedro gestern Abend einen "Supergau" genannt hatte. Zumindest war es das untrügliche Zeichen akuter Höhenkrankheit. Beeindruckt von der Art meiner Erleichterung legte nun auch Marlboro halbverdaute Essensreste vor sich ab. Den anderen ging es nicht viel besser. Sofort fuchtelte Pedro mit den Armen und deutete zurück auf den Höhengrat, den wir eben hinaufgestiegen waren. Ich hatte gerade noch Zeit, meinen Triumph und die atemberaubende Aussicht zu fotografieren, wobei ich mich noch zwei Mal übergab, dann drängte mich Pedro zum Abstieg. Nach weniger als fünf Minuten auf dem Gipfel machten wir folglich kehrt und taumelten zurück auf den Höhengrat. Wir ließen die Erdanziehung den Hauptteil der Arbeit erledigen und uns rasch abwärts ziehen, was auf dem eisbedeckten Pfad, der von tausend Meter tiefen Abgründen flankiert wurde, nicht ungefährlich war. Die meisten Bergsteiger beschreiben es als unfassbares Glücksgefühl, auf dem Gipfel angekommen zu sein. Mir war die Ankunft eher seltsam vorgekommen: Unvermittelt hatte ich das Ziel verloren, das mich während der vergangenen Tage angetrieben und hier heraufgeführt hatte. Erst auf fünftausend Metern Höhe, kurz vor dem Basiscamp, ging es uns besser. Pedro war die Erleichterung anzusehen, als wir alle unversehrt zurück zu unseren Zelten wankten. Noch immer leicht benommen, ließen wir uns hineingleiten und ruhten uns zwei Stunden lang aus, bevor uns Pedro zu einem letzten Abendessen in luftigen Höhen weckte. "Ich wollte es Euch eigentlich nicht sagen", erklärte er kurz darauf Nudel kauend und zog die Augenbrauen in die Höhe. Es war der klassische Auftakt einer Mitteilung, die interessanterweise gerade aufgrund der Tatsache, dass man sie verschweigen möchte, in aller Regel von gesteigerter Bedeutung für den Empfänger ist. "Vorgestern musste sich ein niederländischer Alleingänger an derselben Stelle wie Ihr ebenfalls übergeben. Er entschied sich dennoch, den nahe gelegenen Cerro del Plata zu besteigen. Den Fußspuren nach zu urteilen, hat er das noch geschafft. Auf dem Rückweg hat ihn dann die Höhenkrankheit niedergestreckt. Der erste Trupp, der gestern Morgen losgelaufen ist, fand seine gefrorene Leiche nur vierhundert Meter vom Basiscamp entfernt." Ein niederländischer Alleingänger! Unwillkürlich dachte ich an meinen Sitznachbarn im Flugzeug von Buenos Aires nach Mendoza, der nach der Ankunft so ehrgeizig losgelaufen war. Sollte er der Unglückliche gewesen sein? Pedro blickte müde zu Boden. Die Anstrengung der vergangenen siebzehn Stunden war auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen. Wir anderen schauten ihn dankbar an. Gut, dass wir Grünschnäbel nicht allein losgelaufen waren! "Wisst Ihr, drei Viertel aller Unfälle in den Bergen passieren auf dem Rückweg", fuhr Pedro fort, halb zu uns gerichtet, halb zu sich selbst. "Dann, wenn man vor lauter Enthusiasmus darüber, den Gipfel erreicht zu haben, vergisst, wie anstrengend bereits der Aufstieg war. Viele, die zum ersten Mal im Gebirge sind, stellen sich den Abstieg viel einfacher vor, als er in Wirklichkeit ist. Doch technisch gesehen, ist er deutlich herausfordernder als der Aufstieg. Wir Bergführer predigen das praktisch jeden Tag und trotzdem ähneln sich die Unfälle weiterhin beharrlich. Entweder rutschen die Alleingänger auf dem Rückweg nach einem falschen Tritt ab, stürzen in Felsspalten oder gleich einen Abgrund hinab oder sie bleiben entkräftet liegen und erfrieren." Pedro schüttelte bedächtig den Kopf, wodurch die Nudeln auf seinem Teller ins Wanken gerieten. "Inzwischen gibt es sogar einen eigenen Friedhof für die Toten, die der Aconcagua zu sich genommen hat. Er ist ein unerbittlicher Gigant, ein Mythen beladener Magnet für Abenteurer aus aller Welt und er lässt nur hinauf, wen er für stark genug hält. Ob Ihr es glaubt oder nicht: Die Tatsache, dass es einen Friedhof für die über einhundert verunglückten Bergsteiger des Aconcagua gibt, erhöht dessen Anziehungskraft noch. Eine Rolle spielt dabei natürlich auch, dass der Gipfelsturm vergleichsweise günstig ist. Zweitausend bis dreitausend Euro zahlt man für eine dreiwöchige Tour zur Spitze. Für den Mount Everest muss man locker das Dreifache berappen. So tummeln sich rund um den Aconcagua viele, die wenig Erfahrung vom Bergsteigen haben und das während ihrer Touren oft bitter bereuen. Vielleicht nennt man die Schnee- und Eisfiguren auf den Geröllfeldern der Ostkordilleren darum los penitentes, "die Büßer". Sie sehen aus wie betende Mönche, die in Reih und Glied stehen und auf den Aconcagua blicken, nicht wahr? Das liegt daran, dass der Wind permanent von der einen und die Sonne von der anderen Seite kommt." In dieser Nacht, meiner letzten im Basiscamp, beugten sich Schnee beladene Berggipfel und eisige Büßerfiguren zu mir hinunter, rutschten Geröllfelder unter mir weg und niederländische Bergsteiger verschwanden in Steilhängen. Die Anden hatten mir in den vergangenen sechs Tagen grandiose Ausblicke geschenkt. Sie hatten es mir ermöglicht, höher zu steigen, als die meisten Menschen es jemals tun würden. Doch gleichzeitig hatten sie mir einen Warnschuss vor den Bug gefeuert und mich auf ihre Art darauf hingewiesen, wie unbedeutend ich im Vergleich zu ihnen war – und dass ich dieses eine Mal Glück gehabt hatte. Ich hatte die Urkraft der Anden am eigenen Leib erfahren. Verglichen mit diesem Gebirgszug, der aus Gebieten herauswuchs, die zu den extremsten der Welt gehören, der auf endlose Wüsten und immerfeuchte Nebelwälder herabblickt, verglichen mit diesem längsten zusammenhängenden Bergmassiv der Welt waren unsere Alpen eine nette Hügellandschaft, eine grüne Spielwiese für Touristen und Wochenendausflügler. Tag sieben: Abstieg nach Mendoza Noch etwas Anderes wurde mir klar, als wir am nächsten Morgen den schmalen Pfad vom Basiscamp zur Berghütte hinabstiegen, zunächst über eis- und schneebedeckte Felder, dann über endlos scheinende Geröllhänge, in saftiggrüne Wiesen hinein, die von klaren Bergbächen gespeist wurden und noch weiter hinab, hinein in die Wüsten um Mendoza. Ich hatte verstanden, dass die erreichten Höhenmeter für sich genommen wenig aussagten. In Ecuador existieren Fünftausender, auf die man, wenn man seine fünf Sinne halbwegs beisammen hat, hinaufspazieren kann. Man lässt sich mit dem Jeep auf viereinhalbtausend Meter bringen und steigt dann vollends auf. Aber das ist in den Tropen, wo die Temperatur tagsüber selbst auf fünftausend Meter kaum unter null Grad Celsius fällt. Doch in diesem, unter Bergsteigern bekanntesten, Teilabschnitt der Anden peitschen die Aufwinde gegen die schmalen Höhengrate mit ihren kaum ausgetretenen Pfaden und auf dem Gipfel kann es minus dreißig Grad Celsius und kälter werden. Entscheidend sind beim Bergsteigen immer die Umstände. Nicht vergessen werde ich zum Beispiel, wie Pedro während der zweiten Minipause auf fünfeinhalbtausend Höhenmetern einen doppelt faustgroßen Stein in die Höhe warf und wie der Wind diesen Stein im Flug packte und über die Klippe schleuderte. Als Sport wollte mir das Bergsteigen nicht erscheinen: Da jeder Schritt Überwindung kostete, jeder Atemzug eine Kraftanstrengung war, ging es eigentlich nur darum, durchzuhalten und sich gegen alle auftretenden Widrigkeiten durchzusetzen. Als wir die Berghütte erreichten, stand uns die Anstrengung ins Gesicht geschrieben. Vor Pepes Augen tanzten noch immer Sterne. Marlboro ließ sich sofort in ein Bett fallen. Ich selbst trug einen Vollbart zur Schau, hatte mich wie alle anderen sieben Tage lang nicht gewaschen und spürte das Bedürfnis, mindestens vierzehn Stunden durchzuschlafen. Für den Anfang legte ich mich auf die Mauer, die um die Berghütte gebaut war und wartete auf den Bus nach Mendoza, den Pedro für vier Uhr nachmittags angekündigt hatte. Doch wenn ein Argentinier sagt, der Bus komme um vier Uhr, dann ist das in erster Linie ein symbolischer Richtwert, ein Anhaltspunkt, der verdeutlicht, dass man eventuell heute noch von hier wegkommt. Gegen halb sechs erhob ich mich gähnend von meinem schattigen Schlafplatz und hielt mich bereit. Die Israelis, bis auf Pepe, der noch immer über Kopfschmerzen klagte, hatten sich in der Zwischenzeit um einen kleinen Fernseher in der Hütte geschart, der "Night on Earth" ausstrahlte, den filmischen Durchbruch von Jim Jarmusch. Die Dämmerung war bereits vor den Fensterscheiben der Hütte aufgezogen. Roberto Benigni als durchgeknallter Taxifahrer hatte seinem Fahrgast schon die Grundzüge seines Sexuallebens erläutert, als ein freudiges Hupen ertönte. Der angekündigte Kleinbus brachte uns zurück in die Zivilisation – und mich vor einen Spiegel, vor dem ich mich ausgiebig rasierte. Anschließend ließ ich warmes Wasser über meinen Körper laufen, bevor ich im Bett der Jugendherberge versank. Mein letzter bewusster Gedanke lautete wie folgt: Ich weiß nicht, wer der Erfinder der Dusche ist, doch man sollte Straßen und Plätze nach ihm benennen; er hat der Menschheit einen großen Dienst erwiesen.
Teil I: Bruna Montserrat erklärt mir ihr Buenos Aires Teil II: Vom Fluss verschluckt [druckversion ed 02/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: argentinien] |
| [art_3] Bolivien: Auf den Spuren Che Guevaras und Bruce Chatwins Im Rahmen eines Auslandssemesters innerhalb des Biologiestudiums arbeitete Lennart Pyritz für vier Monate auf der biologischen Station "Los Volcanes" in den bolivianischen Ostanden an einem ornithologischen Projekt. Währenddessen unternahm er mit bolivianischen Freunden auch einige kurze Fahrten durch die Anden. Teil IVa: Häusermeere Ein kurzer Rückblick zwischen den Jahren: Letzte Woche habe ich in der biologischen Station in Los Volcanes noch mit einem eigenen kleinen Projekt begonnen. Ich bin den Fluss einige Stunden stromaufwärts gelaufen und habe an Stellen mit Sandbänken Salzlecksteine aufgehängt und die Spuren der so angelockten Tiere fotografiert. Neben Pekaris und Agutis war auch eine große Raubkatze dabei, ein Puma oder Jaguar, das versuche ich noch anhand von Abbildungen in der Literatur zu bestimmen. An Heiligabend bin ich mit dem befreundeten Biologen Rodrigo zum zweiten Mal per Bus nach Cochabamba gefahren, was diesmal zwanzig Stunden gedauert hat: Der Bus musste die alte unbefestigte Strecke durch die Berge nehmen, weil auf der neuen Route eine Brücke zusammen gebrochen war. In Cochabamba habe ich mit Carolis Familie und Darren, dem britischen Entomologen mit Faible für Insektentattoos, Weihnachten gefeiert. Es war sehr entspannt mit unglaublich viel Essen und Sonnenschein. Abends bin ich mit Carolis jüngeren Brüdern losgezogen in die Stadt, die mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bars und Discos aufwartet. Nachdem Caroli und Darren die Rückreise nach Santa Cruz angetreten haben, habe ich mich mit Rodrigo per Bus zum Regierungssitz Boliviens, der Stadt La Paz, aufgemacht. Der Altiplano war zwar Wolken verhangen, die Stadt dennoch eindrucksvoll: Ein riesiger Talkessel voller Häuser, die sich an sämtlichen Hängen heraufziehen. Oben auf der Ebene ist dann bei 4000 Meter Höhe ein zweites Häusermeer: El Alto. Und hinter allem prangt in der Ferne schneebedeckt der zweithöchste Berg Boliviens, der 6.439 Meter hohe Illimani. Rodrigo und ich wohnen bei einem seiner Freunde - Hugo - in einem kleinen Haus hoch oben am Berg mit Blick in den Talkessel. Die Nächte in dem unbeheizten Steinhaus sind klirrend kalt, doch zum Glück haben wir warme Schlafsäcke im Gepäck. Noch einmal kehre ich in der nächsten Woche zurück zum Arbeiten in den Wald. Danach will ich gemeinsam mit einem Freund - Philipp, der zurzeit eine Famulatur im argentinischen Mendoza absolviert - den Süden des Kontinents erobern. Teil IVb: Ein Tango und drei U's Philipp und ich sind seit gestern in Montevideo, Uruguay, aber ich will am Beginn unserer Reise in den Süden beginnen: Zunächst sind wir nachts in einem rumpelnden Zug von Santa Cruz durch die Sümpfe des bolivianischen Ostens bis in die brasilianische Grenzstadt Corumbá gefahren. Dort haben wir einen Überlandbus nach Campo Grande, Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Mato Grosso do Sul, bestiegen, wo wir uns zwei Tage aufgehalten und unsere durch die Zugfahrt strapazierten Knochen wieder in die richtige Position gebracht haben. Schließlich sind wir, abermals per Bus, südwärts nach Foz do Iguaçu gereist und haben dort zu Fuß die Grenze nach Argentinien überquert. Im argentinischen Nachbarort Puerto de Iguazú sind wir einige Tage geblieben und haben die berühmten Wasserfälle - die breitesten der Welt - bestaunt und den Nationalpark auf argentinischer Seite erwandert. Nach zwei Tagen im Nationalpark ging es per Nachtbus aus Puerto de Iguazú nach Buenos Aires weiter - kein Vergleich zu Nachtfahrten im armen Bolivien: Der Bus schnurrt über glatt asphaltierte Straßen, so dass man in den breiten Sitzen fast so gut schläft wie in einer Pension. Am Morgen gab es sogar ein Frühstück, was eher an eine Flug- als an eine Busreise erinnerte. In Buenos Aires angekommen, haben wir uns um nichts gekümmert, sondern uns als leichte Beute von einer Jugendherbergsangestellten gleich am riesigen Terminal abfangen und in ein Taxi zur Herberge im Zentrum setzen lassen. Buenos Aires ist riesig: Im Zentrum kann man gut und gerne 15 Blocks abfahren und alles sieht nach Großstadtzentrum aus. In der Stadtmitte wurde für die Hauptstraße "9 de Julio" ein ganzer Block abgerissen, so dass den Autos dort 16 Spuren für sich und ihren Vorfahrtskampf zur Verfügung stehen. Es kann schon mal zehn Minuten dauern, diese Asphaltbarriere zu überqueren. Wir haben die Stadt zu Fuß erkundet: Microcentro, das alte Tangoviertel San Telmo mit Märkten und viel herrlicher Straßenmusik, das Hafenviertel La Boca mit knallbunten Künstlerhäusern, aber auch sehr armen Straßen (Diego Maradona, Fußballgott bzw. die Hand Gottes, kommt hierher), der Zoo mit kopulierenden Riesenschildkröten und wegen der Hitze badenden Eisbären und schließlich auch die Plaza mit Kathedrale und dem rosafarbenen Regierungsgebäude, das man aus Nachrichtenbildern kennt. Am Donnerstag unserer Ankunft fand auf der Plaza eine Demonstration der "Madres de la Plaza de Mayo" - Mütter von während der Militärdiktatur in den 70ern und 80ern verschwundenen Menschen (Desaparecidos) - statt. Eine Demonstrantin sagte uns, sie seien jeden Donnerstag dort, mit Kopftüchern zum Zeichen der Trauer und beschrifteten Bannern gegen das Vergessen der Militärverbrechen. Nach drei ereignisreichen Tagen des Umherstreunens in der Stadt haben wir schließlich müde und mit abgelaufenen Sohlen die Fähre nach Uruguay bestiegen. Die Überfahrt über den Río de la Plata war gemütlich. In Colonia, einer alten portugiesischen Siedlung auf urugayischer Seite angekommen, ging es gleich weiter per Bus in die Hauptstadt Montevideo. Die Stadt hat etwas Liebenswürdiges an sich: die Lage am Meer, viele alte, verfallende Kolonialhäuser mit schmiedeeisernen Balkonen und noch ältere, vor sich hinrostende Oldtimer in den ruhigen Straßen. Gestern sind wir abends auf die Hafenmole geschlendert und haben den Fischern bei ihrem Handwerk zugesehen, danach bei Dunkelheit zurück in die Stadt, wo es an vielen Ecken nach Marihuana riecht. Heute haben wir uns Fahrräder ausgeliehen, sind durch die Stadt und bis zum Cerro auf der anderen Hafenseite geradelt, von wo aus man von einer alten Befestigungsanlage einen wunderbaren Blick über die Stadt und das Meer hat. Morgen wollen wir zurück nach Colonia und dort die Altstadt anschauen. Einen Tag darauf dann wieder per Schiff zurück nach Buenos Aires und weiter die Küste entlang nach Süden. Bis dahin, Alles Gute, L. Text: Lennart Pyritz Teil I: Auf in die Anden Teil II: Mit Jesus auf dem Berg und Larven im Fuß Teil III: Der Fliegenmensch [druckversion ed 02/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: bolivien] |
| [art_4] Spanien: La Retirada 1939/40 - Rückzug, Flucht und Internierung Eine historische, fiktive Reportage Der Zusammenbruch der katalanischen Front markiert den Anfang vom Ende des Spanischen Bürgerkriegs. Eine Massenflucht beginnt setzt ein, ganz Katalonien ist in Bewegung. Die Orte auf dem Weg zur französischen Grenze sind mehr als überlaufen. Ein nicht enden wollender Zug von Männern, Frauen, Kindern, Greisen, Zivilisten, Soldaten, Tieren, Fahrzeugen aller Art quält sich durch die katalanische Ebene Richtung Pyrenäen. 4. Februar 1939: Passhöhe zwischen Portbou und Cerbere. Ein kalter Wind treibt Schnee- und Regenschauer vor sich her. Es ist als kämen wir zu spät zu einer Riesenversammlung, sie ist schon beendet, wir gehen durch die nach Hause eilenden Massen. Wir sind nun an der Grenze. Einige Flüchtlinge haben in den Händen Erde, die sie beim Verlassen ihres Dorfes aufgegriffen haben. Ein Garde-mobile Mann öffnet eine solche Faust mit Gewalt und verstreut verächtlich deren Inhalt. Am Nachmittag kommt die republikanische Armee. Von weitem sehen wir sie anmarschieren, sie tragen das Gewehr ordentlich geschultert, das Gewehr der verzweifelten Siege, das Gewehr von Madrid, Guadalajara, Belchite und vom Ebro. Der erste Soldat legt sein Gewehr nieder; ehe er weiter geht, hebt er es noch einmal auf, tastet über seinen Kolben, den Lauf. Einem Garde-mobile Mann geht das zu langsam, er reißt dem Spanier das Gewehr aus der Hand, so als ob er Angst hätte, der Spanier würde schießen. Vom 31. Januar bis zum 9. Februar 1939 begeben sich 453.000 Spanier über die Grenze nach Frankreich, davon 270.000 Soldaten der republikanischen Armee. Allein am Grenzübergang Portbou-Cebere sind es 100.000. 8. Februar 1939: "Allez, allez!", tönt es in den Ohren der Flüchtlinge, die von der Garde-mobile über die Küstenstraße gescheucht werden. Von dieser Straße gehen nacheinander die Zufahrtswege zu den Auffanglagern Argeles, Sur- Mer, Saint Cyprien und Bacares ab. Wir mochten an die 35 Kilometer gelaufen sein, als unsere Kolonnen zum Stillstand kommen. Von vorne dringt die Information bis in die letzten Reihen, dass es nicht mehr weiter geht, wir sind am Meer angelangt. Müde, hungrig und durstig lassen wir uns in den Sand fallen. Schlafen, endlich nicht mehr laufen müssen, nur noch schlafen! Der eiskalte Wind vom Meer oder den Pyrenäen macht uns wieder wach. Es gibt keinen Schutz, keinen Unterstand, wir graben Löcher in den Sand und legen uns hinein. Saint Cyprien ist nichts weiter als ein Stück eingezäunte Sandwüste, auf der vierten Seite das Meer. Es gibt nichts. Kein Trinkwasser, nichts zu Essen, keine sanitären Einrichtungen. Das erste, wofür die französischen Behörden sorgen, ist die Aufstellung von Wachtürmen mit MG - Besatzung. In den ersten Tagen wird die Versorgung notdürftig ausschließlich durch Hilfsorganisationen und Solidaritätsaktionen organisiert: Pariser Metallarbeiter schicken Brot, in den Brotsäcken die aktuelle Ausgabe der l'humanite versteckt. Viele sterben in diesen ersten Wochen. In Saint Cyprien waren 80.000 bis 90.000 Menschen untergebracht. April 1939: LKW rumpeln über die Route Nationale 635. Zwischen den Ortschaften Oloron-Saint Marie und Navarrenx biegen sie ab, halten kurz vor einem Schlagbaum und fahren dann in die lange Lagerstraße ein. Wieder ertönt das penetrante "allez, allez" der Garde mobile, die Menschen springen von der Ladefläche der LKW. Die ersten Spanienkämpfer sind im Camp de Gurs eingetroffen. Bis August 1939 sollten an die 20.000 Spanienkämpfer, darunter 6.000 Freiwillige der Internationalen Brigaden aus 52 Nationen hier interniert werden. Das Lager Gurs wurde in 42 Tagen aus dem Boden gestampft. 382 Baracken auf 24 Hektar. Aus einfachen Brettern mit Dachpappe verkleidet, schützen sie kaum vor Wind und Kälte. Ein zwei Meter hoher Stacheldrahtzaun umgibt das Lager. Die sanitären Bedingungen sind katastrophal, bei Regen verwandelt sich der tiefe Ackerboden in einen einzigen Morast. Allein der Gang durch die zwanzig Meter einer dieser Baracken, die mit bis zu 160 Mann belegt sind, ist ein Gang durch das antifaschistische Europa: Uns gegenüber, gleich in der oberen Box, liegen die Tschechoslowaken der Interbrigaden, neben ihnen die Polen, dann die Ungarn und auf der anderen Seite die Italiener, dann die Jugoslawen. An den langen dunklen Abenden erzählen die Kameraden ihre Geschichten, die polnischen Bergarbeiter, die ungarischen Studenten, die italienischen Terrassiers. Für sie ist die Gefangenschaft nur eine Unterbrechung des Krieges, die Baracke nur eine seltsam veränderte, aber im Grunde immer gleich bleibende Welt des Schützengrabens. Es gilt die Zeit zu nutzen, Körper und Geist zusammen zu halten für den nächsten Einsatz - und es gilt auch hier, hinter Stacheldraht, zu widerstehen. 5. September 2009: Camp de Gurs - unter diesem Schriftzug sind zwei Reihen Stacheldraht in die Mauer des Erinnerungspavillons eingelassen. Ein Laubwald ist auf dem Areal des Lagers gewachsen, alle Spuren scheinen verwischt. Doch es gibt sie:
Auf einem Grab frische Blumen - der Grabstein trägt einen baskischen Namen.
|
| [art_5] Argentinien: Im Kaffeehaus Über eine Stadt und die Eigenheiten ihrer Bewohner erfährt man an den verschiedensten Ecken des täglichen Lebens: in der U-Bahn, auf Konzerten oder beim Einkaufen um die Ecke. Dort, wo es eben menschelt. Kein Platz jedoch eignet sich derart vortrefflich wie das Straßencafé. Ich habe meines recht schnell gefunden. Das ist auch keine große Kunst, denn der Mensch ist bisweilen doch recht träge und bequem. Mein Café liegt gerade mal drei vier Blocks von meinem Apartment in der Avenida Belgrano entfernt.
Das Leben auf der Belgrano ist so eine Sache. Ganz offiziell gehört die Straße fast gänzlich zum Stadtteil Montserrat und in diesem Stadtteil ist jede Menge los. Auf der mächtigen Avenida Entre Rios und auch auf der etwas weiter entfernten Avenida Jujuy steht selten ein Auto still, die Menschen gehen einkaufen und am Wochenende schreien die Kinder, weil sie im nächsten Pancho-Laden die argentinische Variante des Hot-Dogs haben wollen. Vielleicht aber auch nur ein Eis oder einen neuen Fußball. Mein Apartment liegt allerdings auf der anderen Seite, nur zwei Blocks von der Avenida 9 de Julio entfernt. Das ist die breiteste Straße der Stadt und ich wundere mich immer wieder, dass da so wenig passiert. Auf jeder Seite gleich sieben Spuren, da ist man schon froh, wenn man als Fußgänger bei einer Grünphase 50 Prozent der Strecke hinter sich bringt. Doch hat man es erst einmal über die Straße geschafft, ist man im Barrio San Telmo, dem altehrwürdigen Tango- und Künstlerviertel. Das steht zwar als Ausflugstipp auch in jedem Reiseführer, jedoch gibt es unzählige Ecken, wo man den Tango in seiner ursprünglichsten Art erfühlen und genießen kann.
Mein Café jedoch liegt im Herzen Montserrats, am Plaza de Congreso. Um ganz genau zu sein: Ecke Hipólito Yrigoyen und Luis Sáenz Peña, direkt gegenüber der kleinen Plaza Mariano Moreno, wo die Handwerker in der Gegend gern ein Päuschen machen und ihren Mate trinken. Im Herbst kann man seinen Kaffee sogar mit Blick auf das Kongressgebäude schlürfen. Da sitze ich also. Fast jeden Tag. Zum Frühstück. Vor mir liegt dann die Zeitung und der Kellner bringt, ohne dass ich auch nur etwas sagen muss, meinen Milchkaffee und drei Medialunas de manteca. Das berühmte argentinische Gepäck gibt‘s zwar auch in der "Fett-Variante", aber die Butterhörnchen hier sind einfach unschlagbar gut. Drei Wochen hat es gedauert bis ich gewissermaßen als Porteño durchging: Wahrscheinlich liegt‘s aber auch an meiner wenig abwechslungsreichen Frühstückskost und, egal wie blöd ein Mensch sein kann, wenn ein Kerl täglich zur etwa selben Zeit kommt und immer das gleiche bestellt, irgendwann hat man es wohl geschnallt, dass er genau deshalb jeden Morgen hierher kommt. Ich jedenfalls schätze solche Konstanten außerordentlich.
Die feine Witwe im roten Mantel ist heute da. Klar, es ist ja Montag. Außer heute kommt sie auch am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ins Café. Dienstags muss sie wohl bei ihrer Tochter auf das Enkelkind aufpassen und am Wochenende ist die Familie in der Provinz dran. Der dicke Geschäftsmann José mit seinem Vollbart ist ebenfalls hier. Er kommt meist allein, tut so, als würde er arbeiten, ehe einer seiner Klienten auftaucht und er etwas zu hastig seine Zeitung weglegt. Manchmal isst er dann mit seiner Verabredung auch zu Mittag. Allerdings kann man die Speisen hier eher vergessen. Es schmeckt einfach nicht. Zwar sollen hier im Café noch irgendwo im hinterletzten Eck italienische Wurzeln vorhanden sein (wie wohl bei der Hälfte der argentinischen Bevölkerung), aber kochen, nein kochen können sie hier wirklich nicht. "Wünschen Sie noch etwas, mein Herr?" Der Kellner reißt mich aus meinen Gedanken. Nun ja, vielleicht noch einen Kaffee. Mein Blick schweift durchs Fenster auf die Straße. Den ganzen Vormittag lang ist hier Stau. Stop, Go, Stop, Go. Begleitet von Hupen, Schimpftiraden. Zwischendrin sieht man auch zahlreiche Fußgänger, die sich durch den Parcours schlängeln. Heute sind auf der Plaza Moreno keine pausierenden Arbeiter zu sehen, dafür liegen zwei Obdachlose mit kleinen Stapeln Pappe auf den Steinbänken in der Sonne.
Wahrscheinlich haben übereifrige Polizisten die beiden vom größeren und ruhigeren Kongress-Platz vertrieben. Hier dagegen nimmt kaum jemand von ihnen Notiz. Inzwischen hat Maria den Raum betreten. Wie immer neigt die hübsche Literaturstudentin ihren Kopf leicht zu Seite, wirft ihre schwarzen Haare nach hinten, lacht, winkt dem Ober und dem übrigen Personal zu und setzt sich zufrieden mit sich und der Welt auf ihren Platz zwei Tische neben der Eingangstür. Unter dem Arm hat sie die Arbeitsmaterialien für ihre Schüler, die jeden Augenblick eintreffen dürften. Auch sie lässt den Blick schweifen. Ein tuschelndes Pärchen in der Ecke, der dicke José angestrengt geschäftig mit seiner Begleitung debattierend, zwei ältere Damen, die mit ihren riesigen Kuchenbergen kämpfen. Der permanent laufende Fernseher füttert uns mit Nachrichten und als Maria mich erblickt, winkt sie erneut. Ich kenne sie vom Sehen, habe aber noch nie wirklich mit ihr gesprochen. Das ändert sich auch heute nicht. Gerade als ich aufstehen will, steuern zwei Amis auf Marias Tisch zu. "¿Como estas, Maria?", nuscheln die beiden in tiefstem Südstaaten geprägten Spanisch. "Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes?" Satz mit X, jetzt ist sie erst einmal die nächsten 90 Minuten mit "ser" und "estar" beschäftigt und meine Zeitung neigt sich bedrohlich dem Ende entgegen. Ich könnte jetzt natürlich am Kiosk gegenüber der Bibliothek am Kongress noch schnell ein paar weitere kaufen, aber ich vertröste mich, dass ich sie hier sicherlich in den nächsten Tagen wieder treffen werde. Auch wenn sie nicht ganz so zuverlässig erscheint wie Rotmantel und Dickbauch, ein-, zweimal pro Woche lehrt sie hier Ausländern argentinisches Spanisch. Die Chancen auf ein Wiedersehen stehen also mehr als gut und vielleicht kommen wir ja dann ein bisschen zum Reden. Wenn das kein Grund für gute Laune ist.
Ich setze mich hin, schaue auf den Verkehr und warte. Es dauert ungewöhnlich lange heute. "Was wünschen Sie? Kaffee, Medialunas, einen Tostado...?" Ein junges Mädchen schaut mich erwartungsvoll an, aber ich bin zu überrascht, um gleich zu antworten. Erst ihr "Möchten Sie die Karte?" bringt mich zurück in die Realität. Nein, nur Milchkaffee und Medialunas. "Fett oder Butter?" Butter natürlich. Ich bin verwirrt, frage aber nicht mal, was mit "meinem Kellner" los ist. Bestimmt ist er nur krank oder hat Urlaub. Ab morgen ist sicherlich wieder alles wie gewohnt. Ich bin ein wenig verwirrt. Und diese Verwirrung besteht die nächsten Tage fort, ehe sie in Pragmatismus umschwenkt. Schließlich weicht alles einer stillen Trauer. Zwar bekomme ich inzwischen wieder mein Frühstück ohne zu bestellen, meinen Kellner habe ich bis heute allerdings nie wieder gesehen. Text + Fotos: Andreas Dauerer [druckversion ed 02/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: argentinien] |
| [art_6] Costa Rica: Wie wichtig ist die Rolle Costa Ricas für das Weltklima? Kopenhagen / San José Während die einen in Kopenhagen noch über nichtssagende 2-Grad-Ziele diskutieren, arbeitet Costa Rica schon seit Jahren daran, als erstes Land der Erde bis zum Jahr 2021 eine 100prozentige CO2-neutrale Energieerzeugung zu erreichen. Das ist ein hehres Ziel, das aber durch umfangreiche installierte Wasserkraftkapazitäten und einem immer stärker werdenden erneuerbaren Energiesektor aus vornehmlich Geothermie, Biomasse und Windkraft nicht in so weiter Ferne liegt.  Foto: Windkraftpark in Costa Rica Dr. Alvaro Umaña, ehemaliger Minister des Umwelt- und Energieministeriums und Sprecher der costa-ricanischen Delegation in Kopenhagen, stellt insbesondere heraus, dass ähnlich wie in Deutschland sich ökonomische Ziele mit ökologischen Zielen wunderbar vereinbaren lassen. Das zentralamerikanische Land hätte gezeigt, dass es keine volkswirtschaftlichen Einbußen hinnehmen müsse, weil es der Umwelt das nötige Gewicht bei ökonomischen Entscheidungen gegeben habe, heißt es in einer offiziellen Erklärung der EfD-CA (Enviroment for Development – Central America), Costa Ricas führender umweltpolitischer Organisation. Der seit Jahrzehnten immer weiter ansteigende Ökotourismus ist der Beweis dafür, dass mit einem "grünen Konzept" auch Geld zu verdienen ist. Mittlerweile wurde ein Viertel des costa-ricanischen Hoheitsgebietes unter Naturschutz gestellt und immer mehr Touristen nehmen das Angebot einer nachhaltigen Reise in das grüne Herz Zentralamerikas wahr. Zu dieser Erfolgsgeschichte gehört, dass Costa Rica ein Programm aufgelegt hat, dem hohe Aufmerksamkeit in Kopenhagen zukam: "Bezahlung für Services (von) der Umwelt". Im Einzelnen heißt das, dass derjenige, der einen Nutzen aus der Umwelt zieht und / oder diese verbraucht auch dafür zahlen muss. Dies hat unter anderem zur Folge, dass der zentralamerikanische Staat zu den einzigen Ländern der Welt gehört, der mehr Regenwald anbaut als er abbaut. "Wir haben die moralische Autorität, andere Länder zu inspirieren und wichtige Änderungen hervorzurufen, die einerseits die Lebensqualität der Menschen verbessern und andererseits helfen, eine Umweltkatastrophe zu verhindern…", betont selbstbewusst Jorge Rodríguez, Sprecher des Umwelt-, Energie- und Telekommunikationsministeriums (MINAET).
Zu Recht treten die Costa-Ricaner sehr energisch für die Nutzung erneuerbarer Energien ein. Mit einer installierten Kapazität zur Stromerzeugung von gut 2.000 MW erscheinen Ihre Anstrengungen international vergleichsweise gering. Da aber über 90% des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, sollten sich die "großen Umweltsünder" wie z.B. China, USA oder andere Länder Europas den zentralamerikanischen Vorreiter zum Beispiel nehmen und umgehend mit dem zügigen Ausbau erneuerbarer Energien fortfahren. Costa Rica dient dabei als eine Art zentralamerikanisches "Labor" für die Forschung und Entwicklung neuer EE-Projekte und -Produkte. So ist beispielsweise die Erforschung der Sonnenenergie nicht so weit zurück, wie auf den ersten Blick angenommen wird. An der Universidad Nacional (Nationale Universität) in Heredia forschen die einheimischen Wissenschaftler bereits seit über 30 Jahren auf dem Gebiet der Sonnenenergienutzung. "Die solarthermische Nutzung für die Warmwasseraufbereitung sowie für die Schwimmbadheizung in der Hauptstadt San José stehen dabei hoch im Kurs und bescheren uns einen immer weiter wachsenden Kundenstamm", so der Präsident und Eigentümer des costaricanischen Solarthermie-Installateurs SWISSOL S.A. Reto Rechsteiner.  Foto: Solartherme in San José (SWISSOL S.A.) Die technischen Herausforderungen für Erneuerbare Energien sind generell dieselben im Vergleich zu Europa, da unter anderem die Speicherung der erzeugten Energie ein großes Problem jenseits des Atlantiks ist. Die Entwicklung geeigneter Lösungen für die Stromerzeugung in den tropischen Gebieten steht dabei im Fokus, da die in Europa hergestellten Kraftwerke, Solarpaneele etc. trotz ihrer hochwertigen Qualität für viele Costaricaner aufgrund unerschwinglicher Preise sowie fehlender Einspeisevergütung immer noch nicht attraktiv erscheinen. Aber die jüngsten Preisstürze für zum Beispiel Solarzellen auf den Weltmärkten lassen insbesondere die Endkunden von Solarmodulen hoffen und die ökonomische notwendige Netzparität nicht in so weite Ferne rücken. Text + Foto: Claus-Bernhardt Johst
[druckversion ed 02/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: costa rica] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[art_7] Lateinamerika: 200 Jahre Befreiung
Ein Kontinent der Hoffnung - Im Interview mit Walther L. Bernecker In den Jahren 2009 bis 2011 feiern neun Staaten Lateinamerikas ihre Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Spanien, wobei im Jahr 2010 die 200-Jahr-Feiern - bicentenario - ihren Höhepunkt erreichen. Torsten Eßer hat mit Walther L. Bernecker, Professor für Auslandswissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg und profunder Lateinamerikakenner, über die Unabhängigkeit, ihre Folgen und die Perspektiven für den Kontinent gesprochen.
1810 / 2010: Was haben die 200 Jahre Befreiung den Staaten Lateinamerikas gebracht? Zunächst einmal die politische Emanzipation von Spanien. Der großen Masse der Bevölkerung ging es damit aber nicht besser, denn eine soziale Befreiung war damit nicht verbunden. Es handelte sich um eine politische Befreiung, die gut für die Kreolen war; doch für die indigene und schwarze Bevölkerung gab es kaum Veränderungen. Die Situation der indígenas hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in manchen Gegenden sogar verschlechtert, da bestimmte Schutzfunktionen der Krone für sie entfallen sind. Warum hat sich der Kontinent seither so schleppend entwickelt? Wirtschaftshistoriker haben herausgefunden, dass in der gesamten Geschichte die Entwicklungsdifferenz zwischen Lateinamerika und den USA zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit am Geringsten war. Diese Differenz nahm im 19. Jahrhundert deutlich zu und blieb dann im 20. Jahrhundert im Wesentlichen auf dem gleichen Stand. Was ist also im 19. Jahrhundert geschehen, dass der Kontinent so zurückgefallen ist? Dafür gibt es verschiedene Gründe:
Nehmen wir einmal Venezuela. Warum steht dieses Öl-Exportland ökonomisch nicht besser da? |
| [art_8] Brasilien: Stimmen aus der Gegenwelt 10. Weltsozialforum in Porto Alegre Marina Silva, Umweltaktivistin und Präsidentschaftskanidatin der Grünen (Partido Verde): "Die sozialistischen Erfahrungen haben zu den selben Resultaten geführt wie das perverse kapitalistische Modell."
Luiz Inacio Lula da Silva, erkälteter Präsident Brasiliens: "Europa hat im letzten Jahr einen Verlust von 7 Millionen Arbeitsplätzen hinnehmen müssen. Die Menschen in den USA haben im letzten Jahr ebenfalls mehr als 7 Millionen Arbeitsplätze verloren. In diesem Land hier haben wir im vergangenen Jahr dagegen 945.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, alleine im produktiven Sektor. Nimmt man den öffentlichen Dienst noch dazu, sind es über eine Million Arbeitsplätze - und das in einem Jahr, in dem die ganze Welt in der Krise steckte."
Joao Pedro Stedile, Vorkämpfer der Landlosenbewegung MST: "Die Agrarreform kommt langsamer voran als eine schlafende Schildkröte." Camila Moreno, resolute Aktivistin der NGO "Terra dos Direitos": "Das soll ein großes Festival der Linken sein? Ein Treffen der Progressiven? Hier wird doch lediglich über Nebensächliches debattiert. Solange nicht die für Brasilien wichtigen Themen diskutiert werden, solange man die Bevölkerung nicht fragt, ob sie Nuklearenergie will und ebenfalls ungefragt unglaubliche Summen in den Verteidigungshaushalt investiert, Atom-U-Boote und Düsenjäger kauft, solange kann ich nicht glauben, dass sich an dieser Stelle "Die Linke" zusammen geschlossen hat! Wollen wir Spruchbänder sehen auf denen steht: "Nein zu den ausländischen Militärbasen!" Wo aber nirgends geschrieben steht: "Nein zu den nationalen Militärbasen?" Was ist denn das für ein angeblich neuer Diskurs? Was soll sich denn da in den letzten zehn Jahren verbessert haben?" Boaventura de Sousa Santos, portugiesischer Soziologe und Alternativendenker: "Wir werden Kämpfe ausfechten müssen. Mit Konflikten, ohne Zweifel. Nicht immer wird unser Kampf legal sein. Aber er sollte stets pazifistisch sein. Und wenn es nötig ist, werden wir ein paar Landbesetzungen durchführen. Das ist weder Gewalt noch Terrorismus. Das ist lediglich das, was im Raum steht, wenn die Agrarreform nicht vorankommt."
Oded Grajew, ergraute Eminenz des Forums, dessen Mitbegründer er ist: "Wir haben den Prozess des Weltsozialforums verändert. Der Prozess ist jetzt selbstorganisierend. So kann ein jeder die Aktivitäten durchführen, die er durchführen möchte. Jeder kann eine Pressekonferenz einberufen, wann immer er will. Ein jeder kann organisieren, was er für wichtig hält. Hier spielt niemand Papi und sagt den anderen: "Mach dies, mach das!" Marina Silva, Umweltaktivistin und Präsidentschaftskandidatin der Grünen (Partido Verde): "Ich gehöre nicht zu dem Typ Mensch, der sich leicht einschüchtern lässt. Stellen Sie sich einmal vor, jemand wäre zu Mandela gegangen und hätte gesagt: "Hör auf damit. Du bist ein Träumer. Was ist denn das für eine Geschichte, dass Du mit der Apartheid aufräumen willst?" - Was wäre gewesen, wenn er damals aufgegeben hätte?"
Luiz Inacio Lula da Silva, erkälteter Präsident Brasiliens: "Meine lieben Companheiros - nächstes Jahr, wenn Ihr alle wieder bei diesem Forum versammelt seid, werde ich nicht mehr als Präsident, sondern als Ex-Präsident dieses Landes hier sein. Aber mit Sicherheit wird an meiner Stelle eine gleichgesinnte Person stehen, vielleicht mit größeren Fähigkeiten als ich, um dann von dieser Stelle aus, diesem Land zu sagen, was in Zukunft gemacht werden muss." Boaventura de Sousa Santos, portugiesischer Soziologe und Alternativendenker: "Unsere wichtigste Waffe ist der radikale Gebrauch der Demokratie und die Leidenschaft, die wir für die soziale Gerechtigkeit hegen. Eine radikale Demokratie, die ihren Platz in der Fabrik, auf dem Feld, in den Straßen, den Schulen, überall haben muss. Wenn mich jemand fragt, was der Sozialismus des 21. Jahrhunderts ist, so würde ich sagen, dass es die uneingeschränkte Demokratie ist. Nicht mehr und nicht weniger."
Francisco Whitaker, ebenfalls ergraute Eminenz des Forums, dessen Mitbegründer er ist: "Die Welt befindet sich in einem Evolutionsprozess und wir befinden uns in einem Moment großen Enthusiasmus. Vielleicht können wir hier etwas erreichen. Wenn auch nicht die große Wende, so etwas ist nicht mehr möglich. Man kann nicht mehr einfach an die Macht gelangen, alles Alte für ungültig erklären und neue Regeln aufstellen. So funktioniert die Welt nicht mehr. - Nein, die Veränderungen heutzutage kommen von unten, von innen. Und alle Gesellschaftsschichten sind an diesen Veränderungen beteiligt."
Camila Moreno, resolute Aktivistin der NGO "Terra dos Direitos": "Diese Linken hier - um Himmels willen - müssen sich neu definieren. Selbst nach 10 Jahren fehlt es bei ihnen immer noch an allen Ecken und Enden." Oded Grajew, ergraute Eminenz des Forums dessen Mitbegründer er ist: "Wir haben zwar das Forum gegründet. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt hat es sich verselbständigt und wurde von den Menschen übernommen, die mitmachen und mitorganisieren wollen. Das Weltsozialforum hat keine Besitzer, sondern organisiert sich selbst. Das Weltsozialforum ist Demokratie in seiner extremsten Form. Deswegen hat sich das Weltsozialforum rund um die Welt verbreitet, hat eine Zivilgesellschaft auf globalem Level gebildet, hat derart viele Veränderungen bewirkt, hat zur Gründung derart vieler Organisationen beigetragen. Das ist der Reichtum des Weltsozialforums." Francisco Whitaker, ebenfalls ergraute Eminenz des Forums dessen Mitbegründer er ist: "Die Tatsache, dass das Forum in Davos im Jahre 2009 in einer Atmosphäre, die einer Bestattung gleich kommt, abgehalten wurde, vermittelt den Eindruck des Zusammenbruchs des Kapitalismus. Eine neue Krise wie 1929. - Da konnte man deutlich die Grenzen des Systems erkennen. Unsere Prophezeiungen sind eingetroffen: Eine Welt, die offen ist für Spekulation, kann nun mal nicht funktionieren." Nandita Shah, indische Frauenrechtlerin: "I think there's a crisis in the left and in our voice. I hope these five days will bring us out of this visionless tunnel."
Camila Moreno, resolute Aktivistin der NGO "Terra dos Direitos": "Irgendwie entsteht der Eindruck, dass in dieser Generation des Weltsozialforums generelle Blindheit herrscht. Viele Menschen, die diesem Forum beiwohnen, Intellektuelle und Repräsentanten von NGOs, machen mit bei dem Entwurf eines Entwicklungsmodells, das sich schon in ihre DNA hineingefressen hat. Die Leute reproduzieren ein Entwicklungsmodell um des reinen Entwicklungsmodells willen." Francisco Whitaker, ebenfalls ergraute Eminenz des Forums dessen Mitbegründer er ist: "Das System hat Leck geschlagen." Interviews + Fotos: Thomas Milz [druckversion ed 02/2010] / [druckversion artikel] / [archiv: brasilien] |
.