ed 09/2015 : caiman.de
kultur- und reisemagazin für lateinamerika, spanien, portugal : [aktuelle ausgabe] / [startseite] / [archiv]
|
panama: Ach, wie eng war Panama!
Ein Kanal wird ausgebaut (Teil 1) KATHARINA NICKOLEIT |
[art. 1] | druckversion: [gesamte ausgabe]  |
|
|
kuba: Nachrichten aus Kuba (Teil 2)
Ein Gespräch mit dem kubanischen Schriftsteller Leonardo Padura THOMAS MILZ |
[art. 2] | ||
|
spanien: Gran Canaria, Agüimes und die Schlucht von Guadayeque
BERTHOLD VOLBERG |
[art. 3] | ||
|
peru: Pisco, Guano und die Seelöwen
NIL THRABY |
[art. 4] | ||
|
traubiges: Finesse, Frucht und Mineralität
Finca Moncloa: Stattlicher Tinto aus der Heimat des Sherrys LARS BORCHERT |
[kol_1] | ||
|
hopfiges: CARMEN - La Rubia aus Tarragona
MARIA JOSEFA HAUSMEISTER |
[kol. 2] | ||
|
erlesen: It`s the Peronism, stupid!
Fernando Iglesias und der Mythos Peronismo THOMAS MILZ |
[kol. 3] | ||
|
lauschrausch: Herbstmusik
Pablo Milanés und José María Vitier treffen Dom la Nena TORSTEN EßER |
[kol. 4] |
| [art_1] Panama: Ach, wie eng war Panama! Ein Kanal wird ausgebaut (Teil 1) (Teil 2) Die Mirafloresschleusen im Südosten Panamas: Langsam setzt sich die Rupanco aus Monrovia in Bewegung. An jeder Seite führen je drei straff gespannten Stahltrossen zu drei starken Lokomotiven. Sie führen das Schiff und sorgen dafür, dass es im Zentrum der Schleusenkammer bleibt. Und sie helfen dem Schiff, zu bremsen. Aber vor allem halten sie es in der Mitte. Der Kapitän der Rupanco winkt seinem Publikum zu und Dazzel Marshal grüßt zurück. Der junge Mann ist Mitarbeiter der panamaischen Kanalbehörde und trägt wie jeder, der hier arbeitet, eine hellblaue Krawatte, auf der kleine Schlepperboote abgebildet sind. "Das hier ist ein Panamaxschiff. Die Panamaxschiffe haben die maximale Breite, mit der der Kanal noch befahren werden kann. Da bleibt lediglich ein halber Meter auf jeder Seite", erklärt er. Das gut 32 Meter breite Schiff in die nur einen Meter breitere Schleuse hineinzuleiten ist Maßarbeit. Wenn man vor dem Containerschiff steht, wirkt es riesig, fast wie ein Hochhaus. Aber tatsächlich ist es ein verhältnismäßig kleines Schiff. Längst sind viel größere Frachter auf den Weltmeeren unterwegs. "Mehr als fünf Prozent der weltweit gehandelten Waren wird durch den Panamakanal geschleust. Es könnte noch viel mehr sein, aber im Moment haben wir Einschränkungen durch die Schleusen. Wenn die neuen Schleusen erst fertig gestellt sind, werden wir doppelt so viel Fracht haben. Und doppelt so hohe Einkünfte", schwärmt Marshall. Der Panamakanal ist neben dem Suezkanal in Ägypten die wichtigste künstliche Wasserstraße der Welt. Den Schiffen erspart er auf ihrer Reise vom Pazifik in den Atlantik den Umweg rund um Südamerika – rund 15.000 Kilometer. Diese Abkürzung lassen sich die Reeder einiges kosten – 74 US-Dollar werden pro geschleustem Standardcontainer fällig. Das kleine mittelamerikanische Land besitzt mit dem Kanal eine echte Goldmine. "35 bis 40 Schiffe pro Tag. Mehr als 14.000 Schiffe im Jahr. Je nachdem wie viel Fracht sie geladen haben, macht das 6 bis 7 Millionen Dollar täglich. Mehr als 2 Milliarden US-Dollar jährlich. Der Kanal ist Panamas wichtigste Einnahmequelle", weiß Marshall. Damit das so bleibt, wird der Kanal erweitert. Er muss breiter und tiefer werden und braucht vor allem größere Schleusen, auf beiden Seiten des Kanals. Damit künftig auch die "Post Panamaxschiffe" die Meeresstraße passieren können. Nur eine kleine Landzunge trennte die Schleusen von der Baustelle. Oberhalb dieser Baustelle steht eine Aussichtsplattform. Miroslava Herrera, die Dokumentarin vom Panama Canal Expansion Program zeigt auf die vielen Bagger, Kräne und Lastwagen, die an der neuen, dritten Einfahrt in den Kanal arbeiten. Hier entsteht eine Megaschleuse mit drei Kammern. Jede einzelne wird 427 Meter lang und 55 Meter breit sein. Das entspricht jeweils der Größe von vier Fußballplätzen. "Das hier ist die Struktur, über die die Schiffe von der Karibik auf Höhe des Gatunsees angehoben oder in Gegenrichtung nach unten befördert werden sollen. Die meisten Betonarbeiten sind abgeschlossen. Die Mauern sind fertig hochgezogen und man erkennt bereits die Umrisse der gesamten Struktur, vom See bis runter auf Meeresniveau", erklärt Herrera. Auf der einen Seite glitzert die Karibik, auf der anderen der riesige Gatunsee, der die Landenge heute fast zur Hälfte unter Wasser setzt. Die Fahrrinne läuft mitten durch den Stausee. Eine ganze Reihe Frachter warten unten in der Kanaleinfahrt auf ihre Schleusung. In drei Stufen werden sie 26 Meter angehoben. Aber nicht, weil Pazifik und Atlantik unterschiedlich hoch wären. "Wir werden oft gefragt, welcher Ozean höher liegt – sie sind beide auf 0 Metern. Aber dazwischen liegt das Land mit einer Bergkette, die von Alaska bis Feuerland reicht. Das ist das Hindernis, auf das erst die Franzosen stießen, dann die Amerikaner und nun wir." Den Seeweg rund um das stürmische Kap Horn abzukürzen, das war schon kurz nach der Entdeckung Amerikas ein Traum der spanischen Krone. Gold aus Peru und Silber aus Bolivien wurden am Pazifik von den Schiffen auf Maulesel verladen und über Land auf dem "Camino del Oro", dem Weg des Goldes, bis zur Karibik transportiert, um dort erneut auf Schiffe verladen zu werden. König Carlos V ließ bereits 1523 erkunden, ob es möglich wäre, die nur 82 Kilometer breite Landenge zu durchstechen. Dazzel Marshall führt durch die Ausstellung im Besucherzentrum. Der Raum ist dämmrig, alte Fotografien, Modelle, Karten und altes Arbeitsgerät werden mit Geräuschen von Sprengungen untermalt ausgestellt. "Nachdem die Franzosen in Ägypten den Suezkanal gebaut hatten, baten sie um Erlaubnis, auch in Panama einen Kanal graben zu dürfen. Sie wollten einen Kanal auf Meeresniveau bauen. Nach 20 Jahren hatten Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber mehr als 20.000 Menschen getötet. Noch wusste man nicht, dass Malaria und Gelbfieber durch Mücken übertragen werden. Die Franzosen hatten die Schwierigkeiten, die die Arbeit in den Tropen mit sich bringen würde, weit unterschätzt. Vor allem hatten sie nicht mit dem ständigen Regen gerechnet, der das gerade ausgeschaufelte Erdreich zurück in die Grube wusch.1889 gaben die Franzosen die Baustelle schließlich auf. 16 Jahre später setzten die US-Amerikaner das Projekt fort. Statt einem Durchstich durch Basaltgestein auf Meereshöhe entschieden die sich dafür, die Schiffe über Schleusen anzuheben. Sie hatten aus den Fehlern der Franzosen gelernt und schafften den Abraum mit Eisenbahnen weit weg von der Baustelle. Und sie profitierten davon, dass die Wissenschaft in der Zwischenzeit entscheidende Fortschritte gemacht hatte. In Cuba forschte Carlos Finlay darüber, wodurch die Krankheiten übertragen wurden. Alles, was man aus Cuba lernen konnte, wurde hier angewendet: Es wurde gesprüht, Straßen asphaltiert, Mückengitter an den Häusern angebracht. Und es wurde Benzin in kleine Tümpel geschüttet, damit sich die Mücken dort nicht entwickeln konnten", erzählt Marshall. Neun Jahre, nachdem mit dem Bau des Kanals begonnen worden war, wurde er 1914 eröffnet. Ein 82 Kilometer langer, künstlicher Wasserweg, der einen Kontinent durchschneidet und eine Verbindung zwischen zwei Ozeanen schafft – das ist ein gewaltiger Eingriff in die Natur, dessen Folgen sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Jenseits der Baustellen wirkt das Land tropisch grün. Doch Umweltschützer, die sich genauer mit dem Kanal beschäftigen, haben eine ganze Reihe an Problemen ausgemacht. Alida Spadafora von der panamaischen Umweltschutzorganisation ANCON sorgt sich besonders um die Erosion entlang des Kanals: "Wir haben in den 90er Jahren Studien durchgeführt und herausgefunden, dass jedes Jahr pro Hektar 200 Tonnen Erde in den Kanal geschwemmt werden. Das liegt daran, dass ein Teil des Kanals ein Gebiet mit sehr steilen Abhängen durchschneidet. Dort wächst nichts mehr, die Erde ist längst weggewaschen. Es regnet hier viel und jeder Regen wäscht mehr Erde in den Kanal." Das hat nicht nur zur Folge, dass die Fahrrinne regelmäßig ausgebaggert werden muss. Das Sediment wird über die Schleusen in die Ozeane geschwemmt und richtet vor allem in der Karibik schwere Schäden an. "Dort haben wir in der Nähe der Kanalausfahrt Korallen. Das Wasser, das aus dem Kanal kommt, ist voller Sediment, und das beeinträchtigt die Korallen. Sie brauchen kristallklares Wasser um zu überleben. Wenn Du da runter tauchst, dann siehst du, dass alle Korallenbänke tot sind. Und mit Sediment bedeckt", berichtet Spadafora. Die Studie von ANCON ergab, dass die Belastung durch Sediment aus dem Kanal um ein Vielfaches höher ist als bei einem natürlichen Fluss. Das liegt nicht nur an der Erosion, sondern auch daran, dass das Wasser bei den Schleusenvorgängen mit mehr Wucht Richtung Meer schießt. Dieses Problem besteht, seitdem der Kanal gebaut wurde. Doch mit dem Ausbau verschärft sich die Lage. Um das zu erkennen, reicht eine kurze Bootsfahrt. Im schlammfarbenen Wasser des Kanals arbeiten sich Baggerschiffe Kilometer um Kilometer vorwärts. Raupenbagger und anderes schweres Gerät fressen sich ins Ufer und haben tiefe Wunden in den sonst dichten Regenwald geschlagen. Alida Spadafora zeigt nach unten: "Wir sehen ein aufgewühltes, schokoladenfarbenes Wasser, das ist ganz offensichtlich eine Folge der Ausbauarbeiten. Das Erdreich am Ufer ist aufgerissen und wird von keinerlei Pflanzen mehr bedeckt. Und wir haben es hier mit Böden zu tun, die schnell erodieren." Die Erosion, so hat ANCON berechnet, steigt durch die Ausbauarbeiten noch mal um die Hälfte an. Die Erweiterung des Kanals betrifft längst nicht nur den Bau der neuen Schleusen. Die Fahrrinne muss vertieft und der Kanal verbreitert werden. Sowohl auf der Pazifik- als auch auf der Atlantikseite wurde die 15 Kilometer lange Einfahrzone ausgebaut und vertieft, damit die größeren Schiffe dort sicher wenden können. Eine der größten Aufgaben ist der Bau der Zufahrt zu der neuen Schleuse auf der Pazifikseite. Die Abzweigung ist sechs Kilometer lang. "Es war eine Aushebung von 50 Millionen Kubikmetern. Enorm. Und alles reiner Basalt. Der Stein musste weggesprengt werden. Das wurde alles sehr vorsichtig gemacht – aber wir mussten Berge versetzen", berichtet Herrera. Die Vertreterin der Kanalbehörde streitet keine Sekunde lang ab, dass der Ausbau gewaltige Eingriffe in das Ökosystem mit sich bringt. Aber sie betont immer wieder, dass vor jedem Bauabschnitt sorgfältig geprüft werde, wie groß die Auswirkungen auf die Natur sein würden und immer nach einer Lösung gesucht werde, die Umwelt möglichst wenig zu schädigen. Trotzdem wurden rund 500 Hektar Wald gefällt. Die dort lebenden Krokodile, Affen und Faultiere wurden zuvor eingefangen und umgesiedelt – eine in dieser Größenordnung einmalige Aktion. "Parallel zu allen Arbeiten haben wir einen Wiederaufforstungsplan. Für jeden gefällten Baum werden zwei neue gepflanzt." Dass sich die Kanalbehörde um die Wiederaufforstung kümmert, geschieht auch aus Eigennutz. Denn ohne Wald könnte der Kanal nicht betrieben werden. Und das nicht nur, weil die Erosion an den Ufern unkontrollierbar würde. "Der Kanal ist abhängig vom Wasser. Wenn wir kein Wasser haben, dann gibt es hier keinen Verkehr. Deshalb kümmern wir uns um den Wasserhaushalt rund um den Kanal", so Herrera weiter. Auf Google Earth sieht man recht deutlich, dass die Gegend um den Kanal zu den wenigen Gebieten Panamas gehört, in der es noch einen bedeutenden Waldbestand gibt. Mit dem Wiederaufforstungsprogramm stellt sich die Frage, welche Bäume in welcher Kombination auf welchem Untergrund gepflanzt werden müssen, damit der Wasserhaushalt optimal reguliert wird. Das sind Fragen, denen Wissenschaftler des Smithsonian Tropical Research Institutes in Panama Stadt nachgehen. Dr. Michiel van Breugel hält Setzlinge fünf verschiedener Baumsorten in den Händen und erklärt: "Sie haben alle unterschiedlich lange Wurzeln und verschiedene Wurzelsysteme. Sie speichern also das Wasser unterschiedlich. Wir nennen das den Schwammeffekt, wenn die Wurzeln das Wasser in der Erde zurückhalten und nur langsam abgeben." Der Niederländer Michiel van Breugel ist 42 Jahre alt und lebt seit sechs Jahren in Panama. Auf insgesamt 265 Versuchsfeldern hat der Forstwissenschaftler in exakten Vierecken von 45 mal 49 Metern in akkuraten Reihen je 225 Bäume gepflanzt. Die Versuchsfelder liegen in einer hügeligen Landschaft, nicht weit von der Autobahn Richtung Karibik. Ein kleiner Bach rauscht den Hügel hinunter. Manche der Felder sind eben, andere liegen auf unterschiedlich steilen Abhängen. Auf jedem dieser Felder stehen die fünf Baumsorten in immer anderen Konstellationen. "Wir wollten sehen, wie sich die Arten untereinander in ihrem Wachstum beeinflussen. Und wir wollten sehen, wie sie in der Regenzeit das Wasser zurückhalten und es dann in der Trockenzeit abgeben." Für die Kanalbehörde sind die Ergebnisse von Michiel van Breugel enorm wichtig. Wenn es am Kanal Probleme gibt, dann haben die entweder mit zu wenig Wasser in der Trockenzeit oder mit zu viel Wasser in der Regenzeit zu tun. 2012 war beispielsweise ein Jahr mit ungewöhnlich viel Regen. "Es regnete in kürzester Zeit so heftig, dass das Wasser in den künstlichen Seen stieg und die Dämme bedrohte. Wenn die Dämme beschädigt werden, dann muss die Schifffahrt eingestellt werden und das bedeutet ungeheure wirtschaftliche Verluste. Bäume können Regen auch auffangen. Sehen sie sich diese Blätter an: Wenn Regen darauf fällt, bleibt er darauf liegen. Diese Feuchtigkeit verdunstet. Bis zu 20 Prozent des Regens kann so abgefangen werden." Mit der Frage, welche Bäume am besten Wasser verdunsten lassen, beschäftigt sich eine weitere wissenschaftliche Studie der Universität Potsdam. Genug und die richtige Auswahl an Bäumen zu pflanzen, reicht alleine bei weitem nicht aus, um den Kanal mit ausreichend Wasser zu versorgen. Für jeden einzelnen Schleusungsvorgang werden 200 Millionen Liter benötigt, die vom Kanal hinunter in den Ozean fließen. Miroslava Herrera steht auf der Aussichtsplattform oberhalb der Pazifikbaustelle und zeigt auf den riesigen Gatunsee. "Das hier war mal ein Tal, vor mehr als 100 Jahren. Aber der Kanal brauchte ein Wasserreservoir. Zwei Flüsse füllten das Tal mit Wasser, es dauerte drei Jahre, bis das Reservoir voll war. Das ist alles Frischwasser, das durch die Schwerkraft nach unten fließt und die Schiffe bewegt. Der Gatunsee ist etwas kleiner als der Bodensee und enthält 5,2 Kubikkilometer Wasser. Doch wenn erst die dritte Schleuse in Betrieb ist, wird das nicht reichen. In der Trockenzeit steht jetzt schon manchmal nicht ausreichend Wasser für die vorhandenen Schleusen zur Verfügung. Als der Ausbau des Kanals in Angriff genommen wurde, war zunächst überlegt worden, weitere Flächen zu fluten, um das Wasserreservoir zu vergrößern. Man entschied sich jedoch für eine andere Lösung. Text: Katharina Nickoleit Der zweite Teil folgt in der Oktoberausgabe des caiman. Weitere Informationen über die Autorin findet ihr unter: www.katharina-nickoleit.de [druckversion ed 09/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: panama] |
| [art_2] Kuba: Nachrichten aus Kuba (Teil 2) (Teil 1)
Ein Gespräch mit dem kubanischen Schriftsteller Leonardo Padura
Leonardo Padura ist einer der bedeutendsten Vertreter der gegenwärtigen kubanischen Literaturszene. Weltweit bekannt machten ihn seine in den 80er und 90er Jahren publizierten Kriminalromane rund um den Detektiv Mario Conde. Zuletzt wurde Padura für seinen Roman "Der Mann der die Hunde liebte" (2009) von der Kritik gefeiert. Das Buch rekonstruiert die Geschichte der Ermordung Leon Trotzkys durch Ramón Mercader. Wir trafen Padura in Brasilien, wo er Anfang Juli an dem Literaturfestival FLIP teilnahm.
Der Mann der die Hunde liebte ist eine starke Kritik der menschlichen Gesellschaft an sich, und damit auch der kubanischen. Es zeigt Menschen, die die sozialistischen Ideen verraten haben. Ist es auch eine Parabel über kubanische Politiker, und wo liegen die Gemeinsamkeiten zwischen dem in dem Buch beschriebenen Stalin und Fidel Castro? Ich sehe es nicht wie eine Parabel. Ich glaube, dass es möglich ist, das Buch auf sehr unterschiedliche Weise zu interpretieren. Im Grunde ist es erst einmal ein Buch über die Ermordung von Leon Trotzky; es erzählt vom Komplott seiner Ermordung, der Vorbereitung dazu durch Ramón Mercader, den spanischen Kommunisten, der Trotzky letztlich tötet. Und es ist eine Novelle, die über die große sozialistische Idee spricht, die auf dem Papier wunderschön war, die als Projekt wunderschön war. Auf der anderen Seite fordert das Buch aber auch die Schaffung einer neuen Utopie ein. Ich halte die Schaffung einer Gesellschaft mit ganz spezifischen Prinzipien für notwendig, einer Gesellschaft in der alle Menschen gleich, in der alle frei sind und in der man auf demokratische Weise leben kann. Das ist ein wunderbares Prinzip, und hoffentlich ist es der Welt möglich, dies in der Realität zu erschaffen. Im 20. Jahrhundert ist man damit gescheitert, aus vielen Gründen, aber ganz besonders weil solche Menschen wie Stalin aufgetaucht sind. Und ich glaube, dass auch die derzeitige Welt keine befriedigende Antwort gefunden hat, die in der Lage wäre, den Menschen dazu zu bringen, eine bessere Welt zu erschaffen – also jene Welt, die wir im 20. Jahrhundert nicht erschaffen konnten. Und die wir hoffentlich in der Zukunft aufbauen können.
Mir scheint, dass heutzutage sowohl die Linke als auch die Rechte in der Krise stecken. Wo stehen wir da aktuell eigentlich? Ich denke genauso. Ein Beispiel hier aus Brasilien: In einer Kleinstadt regiert der Bürgermeister mit einer Koalition aus zwölf Parteien. Da sind Kompromisse praktisch unmöglich. Diese Parteienvielfalt funktioniert als Regierungsform nicht sehr gut. Dann gibt es noch die klassischen Formen der Zweiparteiengesellschaften, wie die der Republikaner und Demokraten in den USA. Die US-Amerikaner selbst sagen, dass nichts unterschiedlicher sein könnte als ein Demokrat und ein Republikaner, und gleichzeitig nichts sich so ähnelt wie ein Demokrat und ein Republikaner. Oder in Spanien, wo es praktisch nur zwei Parteien gab, die Sozialisten und die Partido Popular, die sich an der Macht abgelöst haben. Jetzt steckt dieses System auch in der Krise. Andererseits haben wir die sozialistischen Systeme mit einer einzigen Partei. Für welches System soll man sich entscheiden? Die Rechte hat die großen sozialen Probleme nicht gelöst. Die Linke hat es versucht, aber ist schließlich stets gescheitert. Schauen Sie heute hier in Brasilien, das von einer linken Regierung geführt wird: auch hier ist die Krise angekommen. Es gibt viele Paradigmen und Modelle, die alle nicht in der Lage waren, Lösungen zu schaffen. Im Grunde tragen die Politiker dafür die Hauptschuld, die keine zufriedenstellenden Lösungen gefunden haben. Da gab es Versuche, die sich gelohnt haben, und derzeit ist der populärsten lateinamerikanische Präsident niemand anderer als Evo Morales. Und er regiert mit einem sozialistischen Projekt, das in nichts an den sowjetischen Sozialismus erinnert. Ich denke dass all diese Versuche ihre Daseinsberechtigung haben, inklusive die Regierung der PT hier in Brasilien. Ich ziehe stets eine linke Regierung einer rechten Regierung vor. Text + Fotos: Thomas Milz Teil 3 des Interviews erscheint in der Oktoberausgabe Eduardo Padura - editora en Brasil: http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Autores/visualizar/leonardo-padura [druckversion ed 09/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: kuba]
|
| [art_3] Spanien: Gran Canaria, Agüimes und die Schlucht von Guadayeque Am 10. Oktober 2014 stehe ich ziemlich abgekämpft auf dem Gipfel des Roque Nublo auf Gran Canaria, als plötzlich mein Mobiltelefon klingelt. Es ist eine französische Freundin, die im Opern-Orchester von Sevilla geigt und mit diesem für ein Konzertfestival in die Inselhauptstadt Las Palmas gekommen ist. Wir beschließen, uns unbedingt zu treffen. Antoinette schlägt dafür übermorgen vor, den Feiertag des 12. Oktober (Tag der Entdeckung Amerikas), weil sie dann tagsüber frei hat. Da sie in Las Palmas, im äußersten Norden der Insel und ich an der Südspitze in Maspalomas wohne, einigen wir uns auf einen Treffpunkt auf halber Strecke. Antoinette hat gelesen, dass Agüimes ein schöner Ort sein soll und man von dort eine interessante Wanderung durch die Schlucht von Guadayeque unternehmen kann.
Und so treffen wir uns, nach ein paar Koordinierungsproblemen (ich war noch nicht ganz wach und eine Haltestelle zu früh ausgestiegen), am folgenden Tag in Agüimes um 11 Uhr vor der Dorfkirche. Die Kirche San Sebastián ist ein klassizistischer Tempel, erbaut zwischen 1787 und 1837 an Stelle eines älteren und kleineren Gotteshauses. Imposant für eine Dorfkirche, beeindruckt sie mit einer monumentalen Doppelturm-Fassade und Kuppel. Das Innere ist dreischiffig. Während der Hauptaltar modern und eher kitschig zu nennen ist (die Madonna ist von einem Glühbirnenkranz umgeben), gibt es im linken Seitenschiff zwei passable spätbarocke Hochaltäre. Einer zeigt die Virgen del Carmen, der größere präsentiert Christus am Kreuz und daneben eine Madonna mit Schwert im Herzen (1770).
Nach einem kurzen Rundgang treten wir wieder hinaus ins blendende Mittagslicht und spazieren etwa eine Stunde durch die Gassen von Agüimes. Antoinette hat nicht zuviel versprochen, es ist wirklich ein schönes Dorf. Im Zentrum erinnert es fast an eine arabische Kasbah, so eng und labyrinthisch verlaufen die Gassen mit niedrigen, oft nur einstöckigen Häusern, die weiß oder gelb gestrichen sind. Überall alte Laternen, wie man sie aus andalusischen Städten kennt. Die Sonne steht im Zenit, messerscharf verläuft die Grenze zwischen grellem Licht und Schatten. Normalerweise wird es auf den Kanaren kaum heißer als 30 Grad, aber heute ist einer dieser seltenen Tage, an denen das Thermometer trotz der gleichmäßigen Passatwinde mindestens 35 Grad erreicht. Jetzt um ein Uhr mittags eine Wanderung durch eine Bergschlucht von 10 Kilometern zu starten, scheint uns keine grandiose Idee. Antoinette schlägt vor, von Agüimes mit dem Taxi bis zum Endpunkt der Schlucht zu fahren, dort ein Mittagessen einzunehmen und am späten Nachmittag von dort zurück zu wandern – "schließlich ginge es dann auch bergab", wie sie meint. Begeistert stimme ich zu. Obwohl wir verhandeln, ist das Taxi für kanarische Verhältnisse recht teuer. Als wir dann die endlos scheinende Piste durch die Schlucht entlang fahren, wissen wir warum. Der Aufpreis erklärt sich durch die Holprigkeit der Piste, eine Belastungsprobe für jedes Fahrgestell. Links und rechts der Talsohle dieser engen Schlucht ragen die Steilwände immer höher empor, von anfangs 300 bis 1300 Meter am Endpunkt.
An einem normalen Wochentag wären wir hier allein entlang gefahren, denn Touristen entdecken diesen Canyon nur selten und Canarios haben keine Zeit für Ausflüge. Aber am heutigen Feiertag sehen wir überall parkende Autos und Motorräder in der Wildnis und Großfamilien mit Grills und Picknickutensilien, die sich unter jeden Schatten spendenden Baum drängen. Die Grußboten der Zivilisation verdichten sich, als wir an den Endpunkt unserer wilden Fahrt gelangen und der Fahrer uns stolz einen Hügel präsentiert – mit Parkplatz, Restaurant-Terrasse, Gästen in Sonntagskleidung. Antoinette ist enttäuscht: sie hatte von der Entdeckung einer wilden, unberührten Bergwelt geträumt und wird nun mit dieser urbanen Invasion konfrontiert. "Bloß weg hier!", flüstert sie mir zu, nachdem uns der Taxifahrer auf dem Parkplatz unserm Schicksal überlassen hat. Wir schlagen einen Pfad ein, der weg vom Restaurant und rund um den Hügel führt. Dieser Hügel ist ein Phänomen. Er erhebt sich im Zentrum genau am Ende der Schlucht von Guadayeque, als ob er auf Befehl der Tourismusbehörde erbaut worden wäre, gerade groß genug, um Restaurant und Parkplatz anzulegen. Und vom Gipfel hat man einen großartigen Ausblick über die gesamte Schlucht. Düstere Felsen türmen sich auf, tief unten schlängelt sich die Piste nach Agüimes und irgendwo fern im Osten sieht man sogar das Meer.
Fasziniert betrachten wir das Farbenspiel des Felsgesteins. Von ockergelb und braun über kräftige Rottöne bis hin zu fast schwarz ist die komplette Farbpalette vertreten. An ein paar Stellen verlaufen die verschiedenen Farben als geordnete Streifen quer entlang der Schlucht, es sieht aus wie abstrakte Kunst. Ab und zu öffnen sich Spalten und dunkle Höhlen im Felsmassiv und fügen dem Kunstwerk schwarze Punkte und Zickzackstreifen hinzu. Wir steigen hinauf zum Gipfel des Hügels, wo man eine winzige Kapelle errichtet hat. Von hier ist der Panorama-Rundblick am besten. Der ganze Canyon von Guadayeque präsentiert sich wie ein langer offener Tunnel hin zum Atlantik. Der obere Teil der Berghänge ist kahl und völlig vegetationslos, im engen Tal ranken sich Kakteen den Hang hinauf. Den Bach auf dem Talgrund sieht man nicht, man kann ihn nur erahnen, dort wo die Pflanzen noch grün statt gelbbraun sind und vereinzelt Bäume stehen. Antoinette erzählt mir, sie hätte gelesen, dass noch vor vier Jahrzehnten intensive Landwirtschaft im Tal des Guadayeque betrieben worden sei, aber dann habe der Tourismus seinen gnadenlosen Siegeszug gehalten. Die Terrassenfelder hier wurden nicht nur aufgegeben, weil die Feldarbeit viel mühevoller war als eine Arbeit im Hotel, sondern auch, weil das Grundwasser von hier weggepumpt wurde, um die Bettenburgen an der Küste zu versorgen. Eine Finca nach der anderen wurde aufgegeben. Deshalb wachsen jetzt in diesem Tal keine Bananen, Mandeln und Mangos mehr, sondern nur noch Agaven, Kakteen und verdorrtes Gestrüpp.
Beim Abstieg entdecken wir auf der Rückseite des Hügels eine ganze Galerie von Höhlenwohnungen, geordnet angelegt mit kleinen Gärten davor und sogar mit Hausnummern über den Eingangstüren. Antoinette ist euphorisch. Am liebsten würde sie sofort eine dieser Höhlenwohnungen mieten oder sogar spontan kaufen. Nur mit Mühe kann ich sie davon abhalten, mit einer alten Dame, die im Schatten vor ihrer Höhlentür sitzt, ein Verkaufsgespräch zu beginnen. Ich gebe zu bedenken, dass es innen doch sehr düster sein müsse, aber dann zeigt sie mir die Stromleitung, die das Licht in die Höhlen bringt. Es ist also für alles gesorgt. Dann – es ist inzwischen drei Uhr nachmittags – dringt verlockender Essensduft aus der Höhle nach draußen und die betagte Besitzerin wird zum Mittagstisch gerufen. In dem Moment meldet sich auch bei uns der Hunger und Antoinettes Augen leuchten, als ich unerwartet verkünde, in meinem Rucksack alles für ein Picknick dabei zu haben. Jetzt müssen wir einen schönen Platz dafür suchen, was nicht so leicht ist, denn meine Begleiterin stellt Bedingungen: der Picknick-Platz sollte eine spektakuläre Aussicht haben, ausreichend Schatten bieten (die Sonne brennt weiterhin gnadenlos), weit weg von Großfamilien mit Grillwolken und schreienden Kindern sein, man sollte den Parkplatz von dort nicht sehen können und es sollte bequeme Felsbänke zum Sitzen geben… "Vielleicht auch noch rund geflochtene Blumenranken als Weinglas-Halter?", frage ich sie spöttisch. "Oh, es gibt sogar Wein?", kommt es entzückt zurück.
Keine 30 Minuten später finden wir einen hübschen Platz. Obwohl, so richtig bequem ist es nicht, der Fels ist hart und glatt, aber ein paar niedrige Mandelbäume spenden genug Schatten und Essen gibt es reichlich: Brot, Thunfisch, Käse, Schinken, Oliven, Tomaten, Kartoffelchips (die guten in Olivenöl frittierten), zum Nachtisch Melone und Mangos und Mandelkuchen. Der Rotwein ist allerdings 10 Grad zu warm. Ermutigt durch die halbe Flasche Rioja "El Coto" (der mit dem Hirsch!), schlägt Antoinette vor, jetzt zu Fuß nach Agüimes zu gehen. Die Entfernung schätzen wir auf ca. 10 Kilometer, leicht bergab und die Sonne steht schon tief. Also marschieren wir los. Leider sind wir nicht die einzigen auf dem Rückweg Richtung Küste. Dicht neben uns donnern die Motorräder und Jeeps der Feiertagsausflügler. Die Landstraße ist zwar asphaltiert, aber die Fahrbahn ist so schmal, dass kaum zwei Autos nebeneinander passen und an ihrem Rand befindet sich entweder ein tiefer Graben oder Geröll, das bei jedem Schritt Staub aufwirbelt. Trotzdem beschließen wir, im Graben zu gehen, um nicht von einem der viel zu schnell fahrenden Wagen überrollt zu werden. Wir kommen schnell voran, obwohl Agüimes wie eine Fata Morgana zwischen Bergen und Meer im flirrenden Abendlicht liegt und nicht näher zu kommen scheint. Fasziniert vom Anblick dieses kanarischen Bilderbuch-Dorfs konzentriere ich mich nicht auf meine Schritte.
Plötzlich rutsche ich auf dem Geröll am Straßenrand aus und stürze. Mein rechtes Knie blutet und die Wunde ist voller Staub und winzigen Steinchen. Da wäre Alkohol zum Desinfizieren gut. Auf der anderen Straßenseite spielt ein etwa zehnjähriger Junge mit seiner älteren Schwester Fußball. Wir fragen sie, ob sie irgendwas Hochprozentiges im Haus haben, womit man die Wunde säubern könnte. Sie schütteln den Kopf. Also opfert Antoinette ein halbes Fläschchen teures Eau de Parfum, obwohl ich das natürlich ablehne. Aber sie besteht darauf. Bald ist die Wunde gesäubert, obwohl sie immer noch ein wenig blutet. Antoinette wickelt ein parfümgetränktes Stofftaschentuch um mein Knie. Der Sekundär-Effekt: mein Knie verbreitet einen Duft wie eine ganze Jasmin-Plantage. Ich trete probeweise auf. Die Schmerzen sind erträglich, also adelante! "Aber so kannst Du doch nicht weiter gehen...", meint das kleine Mädchen voller Mitleid zu mir. Als ich noch etwas humpelnd Richtung Agüimes gehe, höre ich wie der Junge zu seiner Schwester sagt: "Diese Deutschen sind echt hart drauf, die kann so leicht nichts aufhalten." Zufrieden mit diesem Kommentar schreite ich von dannen. Text + Fotos: Berthold Volberg Anfahrt Wer aus ökologischen Gründen auf Mietwagen verzichten will, kann von Las Palmas aus den Bus Nr. 11 (Global) nehmen, der direkt nach Agüimes fährt (Fahrtdauer 30 – 40 Minuten) Aus Maspalomas/ Playa del Inglés kommend nimmt man den Bus Nr. 1 oder 36 oder 90, muss aber in allen drei Fällen in Cruce de Arinaga umsteigen in die Nr. 22 (Fahrtdauer wg. des Umsteigens ca. 1 Stunde)
[druckversion ed 09/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: spanien]
|
|
[art_4] Peru: Pisco, Guano und die Seelöwen
Wenn man Lust hat zu arbeiten, dann kann man hier auch Geld verdienen. Ich zum Beispiel komme aus Sabadell (bei Barcelona) und besaß noch nie so viel Geld wie hier - wenn man Geld haben jedenfalls in dem bemisst, was man normalerweise so kauft: ein Haus oder eine Wohnung, ein Auto. Ich habe seit fünf Jahren dieses Hotel und konnte nicht nur die angrenzenden Häuser erwerben, sondern mir auch eine Wohnung in Lima leisten. Und demnächst lege ich mir ein zweites Auto zu. (Juan, Hotelier in Pisco) Nach ein paar kurzen Tagen in Lima haben wir gestern unsere Südtour begonnen. Da hier demnächst die Regenzeit beginnt, haben wir uns entschlossen, zuerst den Süden und danach erst den Norden zu besuchen.
Der Busbahnhof schuf nicht unbedingt Vertrauen. Einer von uns blieb immer ganz dicht beim Gepäck und kontrollierte ständig die Vorübergehenden. Vielleicht etwas übertrieben, aber Vorsicht ist ja bekanntlich die Mutter der Porzellankiste. In dem Bus waren wir die einzigen gringos, der Rest Peruaner verschiedenster Hautfarbe. Die Busse sind nicht mit unseren Standards zu messen (eine Staubwolke stieg aus einem der Sitze auf, als ich etwas darauf warf), allerdings die Preise auch nicht: sehr preiswert und sie zeigen sogar ein Video (OmU). Bei der Ausfahrt aus Lima kann man die cerros (Hügel) bewundern, die Lima umgeben und an deren Hängen hausähnliche Konstruktionen sich gen Gipfel schieben. Immerhin noch aus Stein... Die Küstenlandschaft ist wüst; im wahren Sinne des Wortes. Leider keine aufregend schöne Sanddünenwüste beim Sonnenaufgang, sondern sehr grau und einfach: wüst. In Peru -vielleicht als Fortsetzung der Tradition Nazca- wird gerne in / auf die Hänge geschrieben: politische oder kommerzielle Werbung, manchmal auch einfach der Name der Region oder anderes. Während der Busfahrt steigen ab und zu fliegende Händler ein und verkaufen Essbares: Früchte, Maiskolben (mit einem uns unbekannten, sehr großkörnigen Mais), Kuchen, Gebäck, Erdnüsse und Getränke. Immer wenn der Bus anhält, gilt unser Blick der Gepäckklappe. Der Busfahrer lässt uns an einer Kreuzung raus, denn er fährt nicht rein nach Pisco. Dort aber überfallen uns schon die Taxis und bald sind wir uns handelseinig. Der Fahrer schließt natürlich die Kofferraumklappe ab. Die Taxis sind klein und halboffiziell und es muss sich auch auf dem Fahrer- und dem Beifahrersitz angeschnallt werden. Der Taxifahrer bringt uns zu der Posada Hispana, einem Hotel der Mittelklasse. Dort treffen wir auf Juan aus Sabadell (bei Barcelona). Leider ist sein Hotel voll belegt, aber er verspricht uns für morgen ein Zimmer. Seine Zimmer, die er uns gerne zeigt, sind wirklich herrlich. Wenn man die Standards von hier anlegt, luxuriös. Und der Preis ist völlig ok. Wir schlafen derweil in einer sehr einfachen Pension (3,5 mal so billig und trotzdem sauber und mit mehr oder weniger warmem Wasser).
An der plaza de armas findet man diese Kirche, die einige erstaunliche Preziosen enthält, die gerne von dem Wächter gezeigt werden. Jedenfalls, wenn die Kinder ihn lassen. Pisco hat angeblich 90.000 Einwohner, von denen man allerdings nichts merkt. Eher Kleinststadtflair. Der Hauptplatz -der hier häufig la plaza de armas, also der Waffenplatz, genannt wird- hat eine schöne Kirche und ein Rathaus im Kolonialstil. Die Leute (wir sehen auch ein paar Touristen) sitzen auf Bänken und schwatzen. Außer der plaza de armas gibt es nicht viel zu sehen, wenn man auf "Sehenswürdigkeiten" aus ist. Wir besuchen eine völlig herunter gekommene Kirche mit Führung und ich spiele ein bisschen mit den Kindern, die versuchen, den Führer nervös zu machen.
Noch traue ich mich nicht, frei mit der Kamera herumzulaufen, sonst hätte ich gestern sicherlich die dreifache Menge an Photos gemacht. Die Farben sind schrill, die Kombinationen sehr ungewohnt, die Gesichter phantastisch! Mal abgesehen von den motorisierten Dreiradtaxis, die sich gestern Abend vor unserer Hoteltür versammelten, als ob sie eine Demonstration abhalten wollten. Es gibt viel Wahlpropaganda, allerdings direkt auf die Häuserwände gemalt. Jeder Kandidat hat, neben seiner Listennummer, auch ein Zeichen. Nicht alle können lesen.
Wie gesagt hält Pisco einige kleinere Sehenswürdigkeiten bereit. Aber die eigentliche raison d’être für die vielen kleinen Reisebüros ist die Halbinsel von Parracas und die in der Nähe liegenden Ballesta-Inseln. Letztere werden auch manchmal die "Galapagos des kleinen Mannes" genannt.
Schließlich ist das Betreten der Inseln nur alle paar Jahre erlaubt, wenn das Guano, der Vogelkot, dort abgebaut wird. Ansonsten sind die Inseln noch nicht einmal für Einheimische zu begehen. Bei der Auswahl des Reisebüros trafen wir zum ersten Mal auf ein Phänomen, das wir auch in Zukunft des häufigeren erleben würden: eigentlich klang das Angebot sämtlicher Organisatoren vollkommen identisch, der Preis war auch derselbe. Nur der Name und die Freundlichkeit der Verkäuferin oder des Verkäufers differierten. Die Halbinsel Parracas liegt ungefähr eine halbe Busstunde vom Zentrum Piscos entfernt. Dort gelangt man zum Hafen, an dem unübersehbar die Hauptbeschäftigung der Tourismus ist. Kaum dem Bus entstiegen, werden einem Mützen, Schals, Filme und sonstige Artikel angeboten, die Touristen eben so brauchen. Die Boote am Landungssteg sind überwiegend dazu gedacht, die gringos zu den Inseln zu transportieren. Aber es gibt immer noch ein paar Fischerboote, die um diese Tageszeit von Pelikanschwärmen umringt sind, die auf Fischreste hoffen. Dort, wo die Fischer solche Reste über Bord werfen, finden sich bis zu hundert Tiere ein. Pelikane (oder zumindest die Art, die wir hier antreffen) sind nicht eigentlich hübsch. Sie haben ein braun-weißes Gefieder, das ein bisschen schmutzig wirkt. Aber wenn sie in der Luft sind und man nur ihre schwarze Silhouette sieht, dann macht sie das zu sehr schönen Vögeln. Ihr Flug ist überaus elegant. Sie fliegen in Schwärmen, und es ist beeindruckend zu sehen, wie koordiniert die einzelnen Tiere hintereinander herfliegen.
Und auf der abfallenden Dünenflanke ist ein riesiger Geoglyph, ein übergroßer Kandelaber zu erkennen. Es ist schwer zu schätzen, wie groß er ist, aber er wird 40 Meter hoch und vielleicht 20 Meter breit sein. Keiner weiß so recht, woher dieser Kandelaber kommt, wer ihn in den Sand gegraben hat und wann. Es gibt viele Theorien, von denen eine besagt, dass der Kandelaber zur Zeit der Parracas-Kultur (700 v. Chr. - 200 n. Chr.) entstanden ist. Und dass dieser Kandelaber in Wirklichkeit ein St. Pedro-Kaktus ist. Aus dem Saft dieses Kaktus wird ein halluzinogener Stoff gewonnen, der hier schon immer von Schamanen für die Zukunftsfindung benutzt wurde. Das andere Extrem besagt, dass der Kandelaber Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Die Linien, die diesen Kandelaber bilden, sind ca. 20 Zentimeter in den Boden gegraben. Und - so zumindest behaupten das die Einheimischen - sie werden nicht gepflegt, nie nachgezogen oder sonst wie instand gehalten. Wenn man sich die Wüstenei um den Kandelaber herum ansieht, kommt einem das reichlich mysteriös vor, denn bei dem Wind, der uns fast die Mützen vom Kopf weht, sollte man eigentlich erwarten, dass der Kandelaber binnen kürzester Zeit zugeweht ist. Dann geht die Reise weiter über den Ozean: ein herrlich blauer Tag reflektiert sich im Wasser und lässt auch dieses tiefblau erscheinen. Der Wind pfeift unablässig, aber wir schauen nur nach vorne und freuen uns an dem herrlichen Wetter. Die Inseln kommen in Sicht und beeindrucken sofort mit einem riesigen Felsbogen, eine Art Durchstich durch die Hauptinsel. Noch bevor wir ganz herankommen liegt links etwas Obskures im Wasser, das der Führer schnell beseitigt. Wir fragen ihn auf Spanisch, was denn das gewesen sei: eine Pinguinhaut. Die Fischer, erzählt er uns, erjagen von Zeit zu Zeit auch einen Pinguin, obwohl das streng verboten ist.
Das nächste, was wir bemerken, ist der unglaubliche Gestank, den Seelöwen und sonstiges Getier ausströmen. Zuerst sehen wir die Silhouetten der Seelöwen unter dem Felsbogen, etwas später dann fahren wir in kaum 30 Meter Abstand an ihnen vorbei. Sie fläzen sich auf den Felsblöcken herum oder springen ins Wasser und baden. Der Lärm, den sie machen, ist absolut beeindruckend. Etwas später werden wir an eine Art Badestrand kommen, an dem einige tausend Tiere liegen: da muss man sich schon fast die Ohren zuhalten. Die Seelöwinnen (-löwen gibt es eigentlich nur ein paar) machen den Eindruck eines völlig entspannten Lebens. Nicht einmal dass Geier eine verstorbene Kollegin zerfleischen, hält sie davon ab, kaum ein paar Handbreit daneben in der Sonne zu liegen. Auf den Inseln gibt es aber nicht nur Seelöwen. Von den seltenen und sehr kleinen Pinguinen, die dort dank des (ziemlich) kalten Humboldtstromes überleben können, sehen wir nur einen Schatten, der sich in die Ecke einer kleinen Grotte drückt. Nur an seinem weißen Brustgefieder ist er zu erkennen. Ansonsten: Vögel, Vögel und noch mal Vögel. Die Guano-Anlagen stören das Bild ein wenig. Ihre Existenz wird etwas verständlicher, wenn man weiß, dass Peru eine seiner goldenen Phasen der Postkolonialzeit dem Guano verdankt. Das Wort "Guano" kommt sogar aus dem Quechua (einer der beiden einheimischen Sprachen Perus und die Sprache der Inka) und bedeutet genau das, was man auch heute unter Guano versteht: (ein natürlicher Dünger aus) Vogelscheiße. Guano wird in Peru seit vielen hundert Jahren als Dünger benützt. Die Inkas kannten es bereits und es war ihnen so wertvoll, dass ein Guano-Dieb dem sicheren Tod ins Auge sehen musste.
Die hoch verschuldete peruanische Regierung sah einen möglichen Ausweg aus der Krise und ließ Guano abbauen, was das Zeugs hielt. Dass Guano über Hunderten von Jahren entsteht, war dabei natürlich nicht so entscheidend. Man muss allerdings zugeben, dass die drei wesentlichen Guano-produzierenden Vogelarten erstaunliche Mengen hervorbringen können: auf einer der Inseln leben bis zu einer Millionen Tiere, die wiederum bis zu 11 000 Tonnen jährlich "produzieren". Und vielleicht hinzufügen, dass Peru mit einer horrenden Summe verschuldet war; sie hofften, die gesamten Schulden mit dem natürlichen Dünger bezahlen zu können. Guano wurde so bedeutend, dass es fast zu einem Krieg zwischen Peru und den USA gekommen wäre, als im Jahre 1852 ein großes Vorkommen auf den Lobos-Inseln entdeckt wurde, und die USA die Inseln schlicht annektierten. Man einigte sich letztendlich gütlich: Peru senkte den Preis drastisch und bekam dafür die Inseln zugesprochen, aber die Idee schien den Nordamerikanern gefallen zu haben: 1856 beschloss der amerikanische Kongress, dass seine Staatsbürger jede Insel im Pazifik oder in der karibischen See mit Guano-Vorkommen, die noch nicht "rechtmäßig" zu einem anderen Land gehöre, besetzen könnten und dass diese Insel zu amerikanischem Staatsgebiet erklärt werden könne und schließlich, dass sie keinesfalls "zurückgegeben" würde, bis die Vorkommen erschöpft seien. Die Vorkommen wurden unter unmenschlichsten Bedingungen abgebaut. Tausende chinesischer Arbeiter - die meisten von ihnen schanghait - arbeiteten unter katastrophalen Umständen: fast nackt, ohne jegliches Recht auf Ruhe oder gar Urlaub. Viele begingen Selbstmord. Zusammen mit den Chinesen arbeiteten Strafgefangene und ein paar Polynesier. John Moresby beschrieb das 1913 mit den Worten, es gäbe kaum eine Parallele hinsichtlich kaltblütiger Grausamkeit. Ähnlich wie das andere große Zeitalter, das des Kautschuks, wurde der Guano-Reichtum jäh durch die Erfindung eines künstlichen und preiswerteren Ersatzstoffes, in diesem Falle dem Kunstdünger - Justus Liebig ist hier der große Name-, beendet. Und da das meiste Geld aus dem Erlös des Guanos nicht in die Hände der Arbeiter gelangt war, sondern für die Staatsschulden aufgebraucht oder im Missmanagement verdunsten war, hieß das schlicht und einfach mal wieder Misere für die Einheimischen.
Auf jeden Fall war der Anblick, Geruch und das Geräusch der vielen tausend Seelöwen mehr als beeindruckend. Ein wirklich schönes Erlebnis! Text + Fotos: Nil Thraby [druckversion ed 09/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: peru] |
|
[kol_1] Traubiges: Wie die Schwalbe im Spätsommer
Álvarez y Díez Verdejo 'Golondrina' Rueda 2014 Der Sommer ist vorbei. Es regnet zwar erst seit heute (gestern bin ich noch in kurzer Hose rumgelaufen), aber nachts fällt das Thermometer merklich – auf 16 Grad. Überhaupt haben die Meteorologen jetzt immer mehr Regen vorhergesagt. Aber immerhin sollen die Temperaturen tagsüber nicht so deutlich sinken: Mitte zwanzig Grad sollen es in den kommenden Tagen noch sein. Der Sommer ist tot, es lebe der Spätsommer – könnte man da ausrufen. Und mit ihm ein ganz eigener Geschmack. Eine Melange aus Grapefruit, Stachelbeere und Zitrone, begleitet von einem Hauch frischer Kräuter und, ganz subtil, Anis. Ach, Spätsommer...  Dieser Geschmack stammt von einem Wein, den ich mir heute Abend ganz feierlich aufgemacht habe. Sozusagen als offizieller Willkommensgruß für den Spätsommer. Ein Wein, genauer gesagt ein Verdejo, den ich zum ersten Mal im Frühling getrunken habe und seitdem nicht mehr vergessen konnte: einen Verdejo aus Spanien von der Bodega Álvarez y Díez aus dem Anbaugebiet Rueda. Dieser Geschmack stammt von einem Wein, den ich mir heute Abend ganz feierlich aufgemacht habe. Sozusagen als offizieller Willkommensgruß für den Spätsommer. Ein Wein, genauer gesagt ein Verdejo, den ich zum ersten Mal im Frühling getrunken habe und seitdem nicht mehr vergessen konnte: einen Verdejo aus Spanien von der Bodega Álvarez y Díez aus dem Anbaugebiet Rueda.
Dort, in den 600 bis 800 Meter hohen Lagen von Nava del Rey, gut 50 Kilometer südwestlich von Valladolid, sind die Böden kalkstein- und kieshaltig. Dort fühlen sich die Rebsorten wie Verdejo, Viura und auch Sauvignon Blanc besonders wohl. Ohnehin legen die Weine aus diesem Anbaugebiet seit einigen Jahren einen beispiellosen Siegeszug hin. Ihre ausgeprägt fruchtige und dennoch trockene Aromenvielfalt kommt in Spanien sehr gut an. Es gibt dort kaum noch Tapasbars, die keinen weißen Rueda anbieten. Álvarez y Díez ist eine der bekanntesten der mehr als 50 Bodegas in Rueda. Ihr Verdejo 'Golondrina' ist ein reinsortiger Wein und stammt aus verschiedenen Lagen der Bodega, die von den hohen Tag- und Nacht-Temperaturunterschieden geprägt sind, die den Trauben diese einzigartige Frische dieses Weines bringen. Der ‚Golondrina’ fasziniert schon durch seine klare Farbe, die etwas mehr Grün als Gelb im Glas leuchtet. Hier entwickelt der Wein ein Bouquet aus voller Frucht: Neben Anklängen an Zitrusfrüchte dominieren Stachelbeere und etwas grüne Paprika, begleitet von Kräutern und eben einem ganz feinen Hauch Anis. Am Gaumen wird diese intensive Frucht noch von einer feinen Mineralik und einer minimal prickelnden Säure ergänzt. Zum Schluss erfrischt der Wein noch durch seinen leicht mineralischen und überraschend langen Nachhall. Dieser Nachhall ist eine ebenso angenehme wie erfreuliche Krönung dieses Weins – und damit eines (hoffentlich) anständigen Spätsommers absolut würdig. La Golondrina ist übrigens die Schwalbe. Die hat zwar mehr mit dem Frühling als mit dem Spätsommer (oder dem Frühherbst) zu tun – aber das sollte den Genuss dieses Weines nicht schmälern. |
| [kol_2] Hopfiges: CARMEN La Rubia aus Tarragona (Katalonien / Spanien) Um es vorweg zu nehmen, es tut sich Großartiges in Sachen spanischer Braukunst. Lokaler Vorreiter, der ein jedes Trinkerherz in Wallung versetzenden artesana-Bewegung, war niemand geringerer als der hochdekorierte Koch Ferran Adrìa mit seiner Kreation inedit. Ein Bier, dass trotz der Zugabe von Koriander, Lakritz und Orangenschalen dezent und ausgewogen auftritt, allerdings in Anbetracht der Lawine, die es losgetreten hat, nicht die Vollendung, die der Meister angepeilt hatte, sondern eher einen Aufbruch darstellt in das heißblütige Olé-Brauhandwerken.
Beide, CARMEN und Rosita, sind Produkte der Brauerei CERVESES LA GARDÈNIA aus Tarragona. Um Rosita ranken sich Geschichten und Legenden, um CARMEN rankt sich jedoch nur Lidl, der gemeine an der Costa Brava allgegenwärtige Discounter. Obwohl ein und dieselbe Brauerei hinter den beiden Bierreihen steckt, gibt es unterschiedliche Webauftritte ohne gegenseitige Verlinkung. Die Texte allerdings sind zum Teil 1 zu 1 übernommen. Zudem ist mir CARMEN außer bei Lidl nirgendwo untergekommen, Rosita aber ist recht weit verbreitet, vom Chiringuito in Pere Pescador bis zum Esclat-Supermarkt in der Provinz. Zur Verkostung Dann aber verdrängen ein angenehm süßlicher, an Vanille und Tabak erinnernder Geschmack die Frucht-Komponenten gänzlich und leiten über in einen lang anhaltenden rauchig herben Abgang. Fazit: Sehr schön und interessant! Koriander und Orangenschalen No! So ist das ganz und gar nicht. Wie CARMEN La Rubia hat auch Rosita, genauer Rosita d’ivori, Koriander und Orangenschalen als Zusätze. Die Entstehung Rositas aber geht auf das Jahr 2007 zurück, dem Gründungsjahr der Mikro-Brauerei CERVESES LA GARDÈNIA. – Hat sich also gar der Koch aller Köche von Rosita inspirieren lassen? Außer Lakritz ist es schon verwunderlich, dass Orangenschalen und Koriander mit von der Partie sind. inedit – Vollendung oder Aufbruch? |
| [kol_3] Erlesen: Es el Peronismo, estúpido Fernando Iglesias und der Mythos Peronismo
Der Journalist und Schriftsteller Fernando Iglesias ist nicht dafür bekannt, Konfrontationen zu meiden. Über die Jahre untersuchte er in seinen Büchern Argentiniens politisches und wirtschaftliches Modell, stellte sich kritisch zur nationalen Ausschlachtung der Falkland / Malvinas Problematik durch die Politik, begründete über hunderte Seiten seine tiefe Abneigung gegen den Kirchner-Clan und entwarf Modelle für eine globale Demokratie.
Mit seinem neuesten Buch "Es el Peronismo, estúpio" erreicht der ehemalige Parlamentsabgeordnete nun jedoch bisher unbekannte Bereiche der öffentlichen Aufmerksamkeit. Kaum ein Tag verging in den letzten Wochen, an denen nicht im argentinischen Fernsehen über Iglesias knallharte These diskutiert wurde: der Peronismo hat das Land zerstört. https://www.youtube.com/watch?v=zyrvcTsE8y4 Über weite Strecken des letzten Jahrhunderts stellten Peronisten den argentinischen Staatschef, und auch der seit über zehn Jahren regierende Kirchner-Clan stellt sich selbstbewusst in diese Tradition. Alleine in den letzten 26 Jahren regierten Peronisten nicht weniger als 24 Jahre. In Iglesias Buch, dass derzeit zu den meist verkauften in Argentinien zählt, räumt Iglesias nun mit einer ganzen Reihe populärer Glaubenssätze auf und entlarvt sie als Mythos: so wurde beispielsweise die Gesetzgebung, die die Bedingungen der Arbeiter in Argentinien verbesserte, bereits vor der Machtergreifung der Peronisten verabschiedet und nicht durch diese. https://www.youtube.com/watch?v=76ZSZxpQb4s Zudem verweist Iglesias auf die historische Nähe des Peronismo zu den Militärs und den Beitrag peronistischer Politiker bei den diversen Militärputschen des letzten Jahrhunderts. Argentiniens Verhältnis zum Peronismus vergleicht Iglesias mit dem einer von ihrem Ehegatten verprügelten Frau, die glaubt, die schlechte Behandlung verdient zu haben. Genau wie die geschlagene Frau nähmen die Argentinier es geradezu widerspruchslos hin, von ihren peronistischen Politikern derartig behandelt zu werden. Im Folgenden findet ihr einige der besten Auftritte von Fernando Iglesias: http://www.continental.com.ar/escucha/archivo_de_audio/fernando-iglesias-en-los-estudios-de-continental/20150819/oir/2899729.aspx Text und Fotos: Thomas Milz Fernando Iglesias auf Caiman.de: http://www.caiman.de/07_09/art_2/index.shtml http://www.caiman.de/01_08/kol_1/index.shtml Weitere Bücher von Fernando Iglesias: La Cuestión Malvinas: Crítica del Nacionalismo Argentino (Ed. Aguilar, 2012) La Modernidad Global: Una Revolución Copernicana en los asuntos humanos (Ed. Sudamericana, 2011) ¿Qué significa ser progresista en la Argentina del Siglo XXI? (Ed. Sudamericana, 2009) Kirchner y yo- por qué no soy kirchnerista (Ed. Sudamericana, 2007) Globalizar la Democracia- Por un Parlamento Mundial (Ed. Manantial, 2006) ¿Qué significa hoy ser de Izquierda? (Ed. Sudamericana, 2004) Twin Towers: el colapso de los estados nacionales (Edics. Bellatera, Barcelona, 2002) República de la Tierra-Globalización: el fin de las Modernidades Nacionales (Ed. Colihue, 2000) [druckversion ed 09/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: erlesen]
|
|
[kol_4] Lauschrausch: Herbstmusik und Elfenklänge
Pablo Milanés und José María Vitier treffen Dom la Nena Es wird (leider) Herbst und dazu gibt es ein passendes Album: Der kubanische Liedermacher Pablo Milanés und sein Landsmann, der Pianist und Komponist José María Vitier, vertonen Vitiers sowie weitere literarische Texte. Los geht es mit Texten von zwei Schwergewichten der lateinamerikanischen Literatur: dem Nicaraguaner Rubén Dario und der chilenischen Literaturnobelpreisträgerin Gabriela Mistral. Darios "Canción de otoño" eröffnet das Album und zieht mich tatsächlich direkt in eine herbstlich, melancholische Stimmung, die sich durch das eher belebte Arrangement von Mistrals‘ Gedicht "Besos" wieder ein wenig aufhellt. Grundsätzlich aber ist dies ein Album zum Zuhören, zum Nachdenken über die Texte. José María Vitier hat sehr schöne und passende Musik für sein Klavier zu den Texten von u.a. José Martí, Ernesto Cardenal oder Federico García Lorca verfasst, die sich um die verflossene, die ewige oder die aktuelle Liebe drehen, oder um das Vaterland (Cuba). Aus Brasilien schweben die Klänge von "Dom la Nena" heran. Dominique Pinto, wie die 24-jährige Sängerin eigentlich heißt, sorgt mit ihrer mädchenhaften Stimme und Instrumenten wie Glockenspiel, Cello oder Ukulele für elf fein gewebte Lieder, die sie in vier Sprachen – manchmal vermischt – interpretiert. Das Eröffnungslied über sie selbst klingt leicht, hat aber noch einen simplen Text. "Vivo na maré" klingt hingegen schon wie ein kleines Kunstwerk. Pinto singt darüber, dass sie kein Zuhause hat. Und tatsächlich war die Brasilianerin, die in Paris aufwuchs und in Argentinien klassisches Cello studierte, zwei Jahre mit ihrem Vorgängeralbum unterwegs um die Welt und hat viel Zeit in Wartesälen, Hotelzimmern und bei Proben verbracht, die sie zum Songwriting genutzt hat. Auch die Schwalbe ("Golondrina"), mein Lieblingssong auf dem Album, steht als Zugvogel für das Reisen. Pinto ist Multiinstrumentalistin, hat aber von ihrem Produzenten, Marcelo Camelo, dezent weitere Instrumente untergeschoben bekommen, die die Stücke abwechslungsreicher klingen lassen, als auf ihrem ersten Album. In ihren Liedern scheinen immer wieder ihre brasilianischen Wurzeln durch, sie liebt alte Sambas, aber frei nach dem Bonmot eines jeden Reisenden – "viel Gepäck verlangsamt das Reisen" – setzt sie ihr musikalisches Erbe sparsam ein. Text: Torsten Eßer Cover: amazon [druckversion ed 09/2015] / [druckversion artikel] / [archiv: lauschrausch] |
.
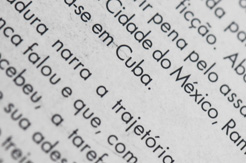
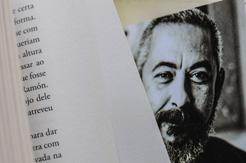

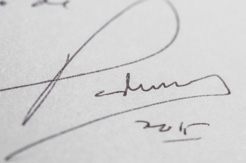














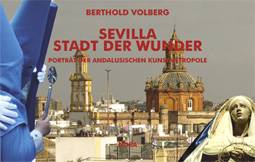









 Heute haben wir es mit einer interessanten, aber suspekten Erscheinung zu tun, mit CARMEN. Genauer mit CARMEN La Rubia. Zunächst fällt auf, dass die Rubia pechschwarzes Haar trägt. Und dass das Etikett, in welches CARMEN eingebettet ist, stark an das Etikett einer anderen Schönheit erinnert, an Rosita.
Heute haben wir es mit einer interessanten, aber suspekten Erscheinung zu tun, mit CARMEN. Genauer mit CARMEN La Rubia. Zunächst fällt auf, dass die Rubia pechschwarzes Haar trägt. Und dass das Etikett, in welches CARMEN eingebettet ist, stark an das Etikett einer anderen Schönheit erinnert, an Rosita. 

