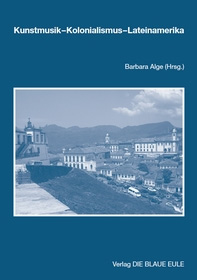ed 08/2017 : caiman.de
kultur- und reisemagazin für lateinamerika, spanien, portugal : [aktuelle ausgabe] / [startseite] / [archiv]
|
spanien: Toledo - Weltkulturerbe und Marzipantorte bei 43° Grad
BERTHOLD VOLBERG |
[art. 1] | druckversion: [gesamte ausgabe]  |
|
|
kuba: Traumhafte Duette
Interview mit der kubanischen Pianistin Marialy Pacheco TORSTEN EßER |
[art. 2] | ||
|
peru: Raftingspass in Peru
TOURISMUSPORTAL PERÚ |
[art. 3] | ||
|
spanien: Aníbal González - der Gaudí von Sevilla
BERTHOLD VOLBERG |
[art. 4] | ||
|
hopfiges: Isenbeck (Argentinien)
ANDREAS DAUERER |
[kol. 1] | ||
|
erlesen: Barocke Liturgie und deutsche Siedler
Kunstmusik-Kolonialismus-Lateinamerika TORSTEN EßER |
[kol. 2] | ||
|
sehen: Nicaragua, Fluch der Langustentaucher
360° Geo Reportage / ARTE |
[kol. 3] | ||
|
lauschrausch: La Migra und die Valle Cousins
TORSTEN EßER |
[kol. 4] |
| [art_1] Spanien: Toledo - Weltkulturerbe und Marzipantorte bei 43° Grad Es gibt wohl kaum eine Stadt, die auf so kleiner Fläche so viele erstrangige Kulturmonumente zu bieten hat wie das kastilische Toledo, zur Zeit Kaiser Karls V. für ein paar Jahrzehnte die Hauptstadt eines Weltreiches, "in dem die Sonne nie unterging". Aber es gibt idealere Tage für eine Besichtigung dieses Weltkulturerbes als einen über 40° Grad heißen Junitag. Doch ich habe es mir vorgenommen, es gibt kein Zurück. So besteige ich am Morgen des 13. Juni in Madrid den vollklimatisierten Zug und bin froh, meinen Rollkragenpullover dabei zu haben, sonst würde ich mir in dem auf Tiefkühltruhe geschalteten Zugabteil wohl eine zünftige Sommergrippe holen. Eine halbe Stunde später komme ich in Toledo an. Um 10.30 Uhr sind es bereits 31° Grad im Schatten. Ich ziehe den Rollkragenpulli aus und nehme ein Taxi zur Plaza Zocodover. Da ich nur etwas mehr als acht Stunden Zeit habe, beschließe ich Toledos Mega-Monument, die Kathedrale, diesmal auszuklammern. Sie ist die fünft- oder sechstgrößte Kathedrale der Welt (größer als der Kölner Dom) und voller Kunstschätze (allein 20 Gemälde von El Greco). Aber erstens habe ich sie bei meinem letzten Besuch vor acht Jahren sehr ausgiebig besichtigt und zweitens rege ich mich jedes Mal auf, weil dies eine der ganz wenigen spanischen Kathedralen ist, wo – trotz des Eintritts von 10 Euro – fotografieren strengstens verboten ist. Warum? Wem gehören denn all die Kunstschätze in diesem Gotteshaus? Der Kirche - also uns allen! (die wir trotz allem immer noch Kirchensteuer zahlen, und gar nicht wenig).
Diesmal also nur außen vorbei, dabei wie immer einen meditativen Blick auf die Fensterrose und den kunstvollen Turm geworfen und weiter. Ohnehin kann man in der Kirchenhauptstadt Spaniens (Toledo war im Mittelalter Europas größtes Erzbistum und ist heute noch Sitz des Primas von Spanien) dem Sakralen nicht entfliehen. Denn heute ist der Tag vor Fronleichnam, dem größten Fest Toledos, und alle engen Gassen sind nicht nur mit Sonnensegeln gegen die Hitze beschirmt, sondern auch üppig mit sakralem Schmuck für die morgige Prozession dekoriert. Ich war schon mindestens sechsmal in Toledo, aber habe längst noch nicht alles gesehen (oder es ist schon so lange her, dass eine Zweitbesichtigung dringend nötig ist). Deshalb habe ich mir für den heutigen Tag ein strammes Programm mit der Besichtigung von acht Monumenten vorgenommen, schön in chronologischer Reihenfolge. Da von den Iberern und Römern kein komplettes Gebäude erhalten ist, beginnen wir also mit den Westgoten: 1. Museum für Westgotische Kultur in der Kirche San Román, 11:00 Uhr bei 32° Grad. Im Reich der Westgoten (ca. 476 - 711) war Toledo erstmals Hauptstadt Spaniens. In dem kleinen Museum kann man Kopien von westgotischen Goldkronen und westgotische Sarkophage und Reliefs besichtigen. Untergebracht ist es in einer der schönsten Kirchen von Toledo, in der Mudéjarkirche San Román, die zwar deutlich jünger ist als die hier präsentierten Exponate, aber doch auf fast 800 Jahre Geschichte zurück blicken kann. Sie wurde zwischen 1250 und 1290 erbaut und die prachtvollen arabisch inspirierten Hufeisenbögen und vor allem die Fresken, die aus derselben Epoche stammen, sind eigentlich wertvoller als die westgotischen Museumsstücke und gut erhalten. Besonders schön: ein Engelspaar, das Weihrauchgefäße schwenkt. Etwas neuer als das Hauptschiff der Kirche ist der schöne Turm aus dem 14. Jahrhundert und der angebaute Renaissance-Chor mit platereskem und vergoldeten Hochaltar aus dem frühen 16. Jahrhundert.
2. Ehemalige Moschee Cristo de la Luz, 12:00 Uhr bei 33° Grad. Im Jahre 712 eroberten die muslimischen Araber die Hauptstadt des christlichen Westgotenreiches und Toledo blieb eine der wichtigsten Städte in ihrem Herrschaftsgebiet. Von dieser Epoche, die 1085 mit der kastilischen Eroberung Toledos zu Ende ging, zeugen neben der Stadtmauer (Puerta Vieja de Bisagra, Puerta Bib-Al Mardón) und der Alcántara-Brücke diese kleine, um 990 erbaute Moschee. Der einfache, aber elegante Ziegelbau ist nur knapp neun Meter lang und breit und wurde nach 1085 in eine Kirche umgewandelt. Der islamische Ursprung zeigt sich unverkennbar in den Sebka-Rautenbögen. Innen hat jedes der winzigen Gewölbe ein anderes geometrisches Muster. Es ist imponierend, wie hier mit einfachen Mitteln und Materialien eine erlesene Dekoration geschaffen wurde, die in einer steilen Gasse seit über 1000 Jahren die Stürme der Zeit überdauert hat.
3. Synagoge Santa María la Blanca, 12.30 Uhr bei 34° Grad. Toledo war während des gesamten Mittelalters eines der wichtigsten Zentren jüdischer Kultur in Spanien, bis zur fatalen Vertreibung der Juden im Jahr 1492. Hier, im "Toledo der drei Kulturen", wurden zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert die Werke von Platon und Aristoteles von jüdischen und arabischen Wissenschaftlern ins Lateinische übersetzt. Und hier steht die älteste Synagoge Europas, vollendet 1220 (der Vorgängerbau war noch deutlich älter). Sie trägt zwar weiterhin den Namen der Kirche, in die sie 1550 umgewandelt wurde, aber aus ihrem Innenraum hat man bis auf ein Kreuz alle christliche Dekoration (Altäre, Statuen, Gemälde) verbannt, um das ursprüngliche Erscheinungsbild des jüdischen Sakralraumes möglichst wieder herzustellen. Der trotz reduzierter Dimensionen fünf schiffige Tempel beeindruckt in seiner Kombination von schlichtem Weiß, eleganten Hufeisen- und Mudéjarbögen und dezenten Vergoldungen in der kleinen Kuppel und den Bögen. Rätselhaft die Kapitelle der Säulen mit ihren Schnörkeln und Pinienzapfen. Die neue Beleuchtung bringt diesen Säulensaal wunderbar zur Geltung. Und obwohl der Raum völlig leer ist, verbringe ich doch viel Zeit hier, denn die Atmosphäre lädt sehr zur Meditation ein. Zudem ist es in diesem 800-jährigen Gemäuer schön kühl und draußen wartet ein Inferno.
4. Synagoge del Tránsito (Sephardisches Museum), 13.30 Uhr bei 37° Grad. Vollendet um 1370, ist sie 150 Jahre jünger als Santa María la Blanca. Architektonisch präsentiert sich diese zweite in Toledo erhaltene Synagoge architektonisch einfacher (nur einschiffig), aber mit noch prunkvollerer Dekoration. Überwältigend gleich beim ersten Blick nach oben das original erhaltene Holzgewölbe im Mudéjarstil, filigran die Fenstergitter aus Stuck, beides dominiert von arabisch beeinflussten Sternenmustern. Reich verziert auch die Wände, sie wirken wie Vorhänge aus Stein, unterbrochen durch zierliche Mudéjarbögen. Die angrenzenden Räume gehörten Samuel Levi, dem Schatzmeister Königs Pedro des Grausamen, und beherbergen heute das Sephardische Museum, in dem anhand zahlreicher Exponate die Geschichte des Judentums in Spanien dargestellt wird. Die spanischen Juden nannten sich selbst Sephardim und trugen über viele Jahrhundert zum wirtschaftlichen Reichtum und zur kulturellen Blüte Spaniens bei - bis zu ihrer tragischen Vertreibung im Frühjahr 1492. Die meisten emigrierten damals ins Osmanische Reich (Istanbul, Thessaloniki), Marokko und (vorübergehend) nach Portugal oder Italien. In vielen sephardischen Familien werden bis heute die alten Schlüssel zu ihren Häusern in Toledo aufbewahrt. Zu den Türen einiger Häuser in dieser uralten Stadt könnten sie heute noch passen.
5. Museo del Greco, 14:00 Uhr bei 38° Grad. Damit eines gleich klar ist: dies hier ist nicht das Haus, in dem der geniale Maler Domenikos Theotokopoulos (El Greco) selbst gewohnt hat, es hätte es aber sein können, weil es im späten 15. Jahrhundert erbaut wurde. Jedenfalls hat man diesen palastartigen Komplex, der eine schöne Holzkuppel im Mudéjarstil besitzt, mit alten Möbeln ausgestattet und präsentiert hier alle Gemälde des großen Meisters, die sich nicht in Toledaner Kirchen oder im Museo Santa Cruz befinden.
Leider kein Geheimtipp, ständig werde ich von lärmenden Touristengruppen verschiedenster Herkunft eingekreist. Im Hauptsaal wird ein kompletter Apostelzyklus mit 13 Gemälden von El Greco gezeigt sowie sein höchst originelles Werk "Ansicht und Plan von Toledo". In einer Zeit, in der fast nur Porträts von Heiligen und Adligen gemalt wurden, war die Darstellung des Panoramas einer Stadt revolutionär, zumal El Greco wie immer eine sehr eigenwillige Vision auf die Leinwand gebracht hat. Zum einen erscheint die Ansicht realistisch-rational, was durch den detaillierten Stadtplan, den sein Sohn unten rechts präsentiert, noch betont wird. Aber zum anderen deutet das verklärte Licht, in das die Stadt getaucht wird und die kleine wilde Engelsschar, die darüber schwebt, die mystische Sicht des Malers an. Komplettiert wird die Sammlung des Museums durch teils interessante Gemälde von Imitatoren und Nachfolgern El Grecos (v.a. Luis Tristán). Obwohl El Greco erst als Erwachsener nach Toledo kam, hat er mit seinen Werken diese grandiose Stadt geprägt wie kaum ein anderer - und wiederum hat die Atmosphäre dieser steilen Gassen, die sich den Fels hinauf ziehen, ihn zu Kreationen inspiriert, die an einem anderen Ort kaum so entstanden wären. Kurz nach 15:00 Uhr. Als ich die kühlen, klimatisierten Säle des El Greco Museum verlasse und wieder auf die Straße trete, glaube ich, geradewegs in einen Ofen zu marschieren. 40° Grad im Schatten und zurück ins Zentrum geht es natürlich steil bergauf. In Toledo gibt es überhaupt nur steile Gassen! Nach ein paar Schritten läuft der Schweiß in Strömen. Zum Glück erinnere ich mich, dass es bei Santa Maria la Blanca einen Getränkeautomaten gibt und stürze eine Dose eiskaltes "Aquarius" in mich hinein, bevor ich die Gasse empor klettere. Vor dem nächsten Monument muss dringend eine kurze Pause her. Was isst man in Toledo -– auch bei 40° Grad - natürlich Marzipan! Bei Santo Tomé sitze ich in einem Café und bestelle ein großes Stück Marzipantorte bei einer Kellnerin, die meint, sich verhört zu haben. Denn die Touristen ringsumher essen Eis oder eiskaltes Gazpacho. Mir egal. Marzipan geht immer und Toledo hat das beste der Welt. 6. Museo de Santa Cruz, 16:00 Uhr bei 41,5° Grad. Ich muss raus aus dieser Sonnenglut, bevor ich kollabiere. Selbst wenn ich nicht an Kunst interessiert wäre, würden die kühlen Säle dieses stattlichen Renaissancepalasts ein verlockend angenehmer Aufenthaltsort sein. Und das ist nun echt unglaublich, aber im Gegensatz zum Museo del Greco bin ich hier ganz allein! Dabei ist Santa Cruz das deutlich wichtigere Museum. Ein Dutzend sehr großformatiger Werke El Grecos gibt es hier auch (das schönste ist wohl die "Inmaculada"). Und dazu ein paar sehr bedeutende Werke mittelalterlicher Kunst und der Renaissance von flämischen und spanischen Meistern. Auch Skulpturen wie die wunderbare Madonna ("Virgen de la Expectación", ca 1530) von Diego de Siloe, einen Hochaltar des größten Bildhauers von Toledo, Alonso de Berruguete (ca. 1540) und erstrangige Gemälde (u.a. vom Barockmaler Ribera und vom unterschätzten Toledaner Renaissance-Maler Correa de Vivar) präsentiert dieses viel zu wenig besuchte Museum.
Allein das Gebäude ist den Besuch wert. Erbaut wurde dieses ehemalige Klosterhospital in Toledos goldenem 16. Jahrhundert vom Architekten der Katholischen Könige, Enrique Egas (die spektakuläre Fassade im plateresken Stil, 1514) und vom Architekten Kaiser Karls V., Alonso de Covarrubias (Renaissance-Patio, ca. 1530). 7. Barockkirche San Ildefonso, 17.30 Uhr bei 43° Grad nach steilem Aufstieg. Geschlossen! Jetzt bin ich aber sauer! Schon sechs Mal habe ich vor dieser barocken Jesuitenkirche mit der imposanten Doppelturm-Fassade gestanden und jedes Mal war sie zu. In Schweiß gebadet habe ich mich bei 43° Grad hier hoch gequält und alles umsonst! Also beim 7. Mal...
8. Kirche Santiago del Arrabal. Vor dieser ältesten Kirche Toledos habe ich auch schon sechs Mal vor verschlossenen Türen gestanden. Ich habe auch diesmal wenig Hoffnung, als ich außen herum gehe. Ältester Teil des Tempels ist sein Turm, von dem einige meinen, er sei ein ehemaliges Minarett (dann müsste er vor 1085 errichtet sein). Wahrscheinlicher ist, dass er kurz nach der christlichen Eroberung ca 1150 erbaut wurde. Die Kirche wurde zwischen 1230 und 1260 erbaut und sieht von außen eher aus wie eine Moschee mit ihren arabischen Hufeisenportalen und Sternenfenstern. Und sie ist tatsächlich offen - zum ersten Mal!
Seit 1984 will ich diese Kirche besuchen und immer war sie zu. Ganz langsam wie in Trance trete ich ein. Santiago del Arrabal ist von beeindruckend schlichter Schönheit. Wären nicht der Hochaltar und ein paar Kreuze an den Wänden, könnte man diese Kirche auch innen für eine Moschee halten. Die Hufeisenbögen setzen sich, wenn auch sehr in die Länge gestreckt, als Blendarkaden an den Wänden fort. Stille erfüllt den Raum. Nur ein paar Großmütterchen murmeln den Rosenkranz. Abseits der Touristenströme herrscht in diesem 800 Jahre alten Tempel eine mystische Atmosphäre. Ich wage kaum, umherzugehen und zu fotografieren. Der Renaissance-Altar ist nur dezent vergoldet und stört die Harmonie in der alten Kirche nicht. Ich setzte mich ins Halbdunkel und vergesse die Zeit. Glockengeläut erinnert mich daran, dass es bald 20:00 Uhr ist.
Nun muss ich möglichst schnell zum Bahnhof. Es gäbe zwar noch zwei spätere Züge zurück nach Madrid, aber die waren schon ausgebucht. Wenn es nicht 43° Grad wäre, könnte man von hier zu Fuß zum Bahnhof laufen (knapp zwei Kilometer). Aber ich bin nicht sicher, ob ich von der Puerta de Bisagra aus den Weg finde und viel Zeit bleibt nicht. Kein Taxi weit und breit. Ich entschließe mich, die paar hundert Meter zu den Rolltreppen zu laufen, um zurück zur Plaza Zocodover zu kommen, wo es immer Taxis gibt. Die berühmte Rolltreppe, hinter einem Sichtschutz versteckt, um das Weltkultur-Panorama nicht zu stören, wurde von der UNESCO erlaubt, um Fußgänger vom Touristenbusparkplatz schnell nach oben in die Altstadt zu bringen. Aber es ist nicht eine Rolltreppe, sondern vier oder fünf. Mir kommt es vor, als wäre die Strecke ein paar Kilometer lang. Es dauert endlos lang und ich werde nun doch nervös. Eine Übernachtung in Toledo war nicht eingeplant und wegen Fronleichnam werden alle Hotels ausgebucht sein. Endlich komme ich oben an, habe keinen Blick mehr für die Schönheit der Stadt, mir brennt der Schweiß in den Augen und ich sehe fast nichts. Mir bleiben weniger als 20 Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Ich stürze halb blind zum Taxi und lasse mich ins Polster fallen. Drei Minuten vor Abfahrt erreiche ich den Bahnhof und muss wieder den Rollkragenpulli für den eisgekühlten Zug auspacken. Und ich nehme mir vor: beim nächsten Mal werde ich in Toledo übernachten, endlich San Ildefonso besichtigen und in der Kathedrale fotografieren - selbst wenn man mich dafür einsperrt... Text + Fotos: Berthold Volberg Tipps und Links: Kirche San Román / Westgotisches Museum: turismocastillalamancha.es/patrimonio/museo-de-los-concilios-y-de-la-cultura-visigoda-3761/descripcion/ Synagoge del Tránsito: museosefardi.mcu.es Museo del Greco: museodelgreco.mcu.es Museo de Santa Cruz: www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-santa-cruz/ Marzipan: Die Marzipantorte gibt es im Café neben der Kirche Santo Tomé, das beste Marzipan kauft man in der Konditorei Santo Tomé (Calle Santo Tomé Nr. 3; am leckersten sind die Marzipan-Pralinen mit Pinienkernen): mazapan.com [druckversion ed 08/2017] / [druckversion artikel] / [archiv: spanien] |
| [art_2] Kuba: Traumhafte Duette Interview mit der kubanischen Pianistin Marialy Pacheco Die kubanische Pianistin Marialy Pacheco, die "größte unter den jungen Pianotalenten" wie Chucho Valdès sie lobte, hat sich auf ihrem neuen Album ein paar Träume erfüllt. Und: Sie ist nun deutsche Staatsbürgerin. Wie hast Du Dir deine Duett-Partner ausgesucht? Begonnen hat alles damit, dass Eva Bauer mich fragte, ob ich nicht noch eine Platte machen wolle. Dann habe ich mit meinem Manager Klaus [Wingensiefen] überlegt, was ich machen könne, und da ich zuvor schon solo und im Trio Alben aufgenommen hatte, kamen wir auf Duette. Ich habe dann eine Liste von meinen Lieblingsmusikern erstellt, Musiker mit denen ich schon lange zusammen spielen wollte. Da standen Pat Metheny, Mariza, Avishai Cohen, Michel Camilo u.a. drauf, eine "Traumliste" eben. Wir haben alle angeschrieben und Miguel Zenón, Hamilton de Holanda, Omar Sosa und Max Mutzke haben spontan zugesagt, andere hatten keine Zeit, und manche haben nicht geantwortet. Bei Michel Camilo hat sein Label einer Zusammenarbeit nicht zugestimmt. Mit Omar Sosa geht es los… Ich wollte unbedingt mit einem Pianisten - oder zwei – Titel einspielen. Mit Omar bestand bereits Kontakt, einmal weil er mir zu meiner Platte "Introducing…" gratuliert hatte und zum anderen weil er meine Tante auf Kuba kennt. Sie ist auch Musikerin und ich hatte ihm bei einem Konzert Grüße von ihr bestellt. Als er das Konzept von "Duets" gelesen hat, war er sofort dabei. Sowohl er wie ich haben zum ersten Mal mit einem anderen Pianisten etwas eingespielt. Aber obwohl wir unterschiedliche Spielweisen haben, gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen uns. Das hört man besonders gut auf dem Bonustrack. Das war eine Probe, von der wir nicht wussten, dass der Techniker sie mitschneidet. Wir kamen rein, ich habe mich an meinen Bösendorfer gesetzt, Omar an einen Steinway und dann haben wir angefangen. Der reguläre Titel auf der CD ist von Omar. Er ist ein sehr spiritueller Mensch und so ist auch sein Stück, wunderbar tief und spirituell. Erlebt man Duette mit zwei Pianos so selten, weil dort die Gefahr der Konkurrenz größer ist? Vielleicht, aber bei uns war das kein Problem. Wir sind uns da sehr ähnlich: es geht nicht um Konkurrenz, sondern um den Dialog. Das ist übrigens auch meine Herangehensweise bei den anderen Duetten. Bei mir geht es immer nur um die Musik. Ich denke, als Profi muss man irgendwann an einen Punkt kommen, wo es nicht mehr wichtig ist, sich profilieren zu müssen. Haben alle Duett-Partner Stücke mitgebracht? Bei der Auswahl der Musiker war mir wichtig, dass sie eine starke musikalische Identität haben, dass man sie mit geschlossenen Augen nur am Klang erkennt. Also musste ich Stücke aussuchen, die das unterstreichen. Von Hamilton habe ich viele Platten durchgehört und dachte bei "Capricho do sul", dass es sich gut auf Klavier übertragen lässt, denn das ist nicht so einfach von der Mandoline her, bei der alles nah zusammen liegt. Außerdem gibt es harmonisch Platz für Improvisation, das war mir wichtig, und es ist rhythmisch, denn wir haben ja sonst keine Begleitung. Bei Miguel und seinem Klang dachte ich direkt an "La comparsa" von Ernesto Lecuona und konnte mir die Melodie schon auf dem Saxophon vorstellen. Ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich höre, wie er beginnt zu spielen. Wir haben zwei takes gebraucht, fertig, auch weil ich wusste, dass er sich mit dem Stück identifizieren konnte. Kuba und Puerto Rico liegen ja nicht so weit auseinander. Max habe ich auf einem Festival getroffen und wollte unbedingt etwas mit ihm aufnehmen. Das Stück von ihm ist auf seiner Platte sehr poppig, aber ich dachte direkt daran, daraus eine Jazzballade zu machen. Max erzählte dann, dass er diesen Song bisher nie live gesungen habe, aber es mit meinem Arrangement gerne machen würde. Mit Rhani spiele ich momentan ohnehin in einem Duo-Projekt. "Burundanga" ist ein Arrangement, das ich zunächst für mein Trio geschrieben habe. Der Titel ist perfekt für Rhani. Da kann er alles zeigen, es gibt ruhige Passagen, aber eben auch den groovigen Mittelteil. Joo wiederum arbeitet sehr viel mit Effekten bei seiner Trompete. Darum habe ich meinen Titel "Metro" ausgewählt, der dadurch spaciger wird, und in dem es um den Traum von einer U-Bahn in Havanna geht. Bei der Auswahl aller Titel habe ich mich immer an der Persönlichkeit der "Jungs" orientiert. Warst Du nochmal in Havanna? Vergangenes Jahr habe ich ein Privatkonzert für den Deutschen Botschafter dort gegeben, zusammen mit meinem Bruder, der auch Pianist ist. Danach spielten wir noch ein Konzert im Theater Bellas Artes. Und wann wird Havanna eine Metro haben? Niemals (lacht!). Dann passt der Science-Fiction-Sound von Joo Kraus ja gut… Ja, genau, das ist Science Fiction… Wie kamst Du auf die Idee, mit Dir selbst im Duett zu spielen? Das ist Klaus schuld. Es sagte, wenn ich mit anderen spiele, dann solle ich doch auch mit mir im Duett spielen. Ich war überrascht, aber fand die Idee dann cool. Und dann habe ich mir noch einen Titel von Lecuona ausgesucht und ihn für zwei Flügel arrangiert. Der Studiotechniker war verwirrt als ich erst den einen und dann den anderen Part aufnahm. Dann habe ich das gleiche mit dem mexikanischen Volkslied "La bikina" gemacht. Und mit dem "Imperial" klingt das wie ein Orchester. Er hat ja fünf schwarz gemalte Extra-Tasten mit tiefen Tönen, die den Resonanzkörper vergrößern. Spielen tut man sie normalerweise nicht, aber der Klang ist trotzdem wahnsinnig. Wenn ich die international bekannten Jazzpianisten aus Kuba aufzähle, ist nur eine Frau dabei: Du! Wie kommt das? Das ist richtig, einerseits cool, andererseits werde ich manchmal nicht so ernst genommen wie die Männer. Ich muss immer ein wenig mehr kämpfen, denn 1. bin ich Latina, da kommen dann schon viele Klischees hoch und 2. eine hübsche Frau, darum denken viele ich müsste auch singen… die Frage danach hasse ich am meisten, zumal ich keine schöne Singstimme habe. Und Musik sollte nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Für mich geht es immer nur um Qualität, egal ob Frau oder Mann. Aber nach meinem Konzert ist das dann auch klar. Das gute kubanische Musikerziehungssystem durchlaufen ja auch viele Frauen, zumindest habe ich am Konservatorium in Havanna viele gesehen. Wo bleiben die danach? Für den Jazz kann ich sagen, dass der Weg dorthin hart ist. Denn wir werden ja klassisch ausgebildet und wenn du Jazz spielen willst, musst du dir das selbst beibringen: von Platten, auf der "Straße" etc. Ich wollte das unbedingt, aber das halten Frauen vielleicht nicht so gut durch. Und auch in den populären Salsa-Bands, wo man etwas anderes lernen könnte, werden i.d.R. als Musiker nur Männer engagiert, die Frauen dürfen singen. Und dann kommt noch das überall gleiche Problem hinzu: Frauen wollen evtl. Familie haben und das kollidiert dann mit einer Musikerkarriere. Text: Torsten Eßer Cover: amazon Tourtermine: 22.09. Viersen, Jazzfestival 26.09. Berlin, Piano Salon Christophori [druckversion ed 08/2017] / [druckversion artikel] / [archiv: kuba] |
|
[art_3] Peru: Raftingspass in Peru
Peru durchkreuzen zahlreiche Flüsse. Das sind 7.000 Flußkilometer von Lima bis Iquitos und von Tumbes bis Cusco. Für Raftingbegeisterte bedeutet das viel Abwechslung. Dabei ist für alle etwas dabei, denn die Schwierigkeitsgrade reichen von I bis V. Ein reißendes Vergnügen für Anfänger wie Könner – und das vor magischer Kulisse.
Rafting in den Anden: der Rio Apurimac bei Cusco Der Apurimac zählt zu den bekanntesten Rafting-Zielen in Peru und hat die Schwierigkeitsgrade II, III und IV. Der sehr tiefe Fluß entspringt südwestlich von Caylloma auf über 5.000 Metern und schlängelt sich durch beeindruckende Landschaften hinunter zu den heißen Quellen von Cconoc in Curahuasi. Insgesamt überwindet der Apurimac über 600 Kilometer und mehr als 3.500 Höhenmeter. Verschiedene Anbieter organisieren Touren jeder Art, beliebt sind Mehrtagestouren mit zwei Übernachtungen. Von Cusco aus geht es vier Stunden durch die Anden bis zur Einstiegsstelle an der Brücke Huallpachaca, hier startet der nasse Nervenkitzel der mehrfach unter die 10 besten Raftingtouren der Welt gewählt wurde. Die Stromschnellen haben vielsagende Namen wie "Zahnschmerz", "du zuerst" oder "letztes Lachen". Gekrönt wird jede Tour vom Anblick der Salkatany-Bergkette, einer der schönsten Kordilleren der Welt.
Rafting an der Pazifikküste: der Rio Cañete südlich von Lima Der Fluss Cañete liegt südlich von Lima inmitten dem fruchtbaren Obst- und Weinanbaugebiet Lunahuaná, einem beliebten Ausflugsziel der Hauptstädter. Mit zahlreichen Passagen der Schwierigkeitsstufe V, hohen Wellen und aufbrausenden Stromschnellen zählt der Cañete zu den beliebtesten Raftinggebieten in Lateinamerika. Von Halbtagestouren aller Niveaus bis hin zu Mehrtagestrips von den Ausläufern der Anden bis zur Pazifikküste ist für jeden das richtige Angebot dabei. Eines ist sicher: Das Adrenalin fließt dabei schneller durch die Adern als das Wasser den Cañete hinunter. Wer anschließend etwas Erholung nötig hat, sollte eine Verlängerung in einem der umliegenden Weingüter buchen.
Rafting im Regenwald: der Amazonas Ein ganz besonderes Erlebnis ist eine Raftingtour auf dem gewaltigen Amazonas, der zweitlängste Fluss der Erde. Wer keine Lust auf die herkömmlichen Schlauchboote hat kann sich unter Anleitung des Guides sein eigenes Schilffloß basteln und sich darauf durch die Fluten tragen lassen. Einmal im Jahr blickt die internationale Raftingwelt nach Iquitos im peruanischen Amazonasgebiet, denn dann findet "The River Amazon International Raft Race" statt, laut dem Guinness Buch der Rekorde das längste Floßrennen der Welt. Seit 1999 geht es jedes Jahr im September oder Oktober für die vielen hundert Teilnehmer während drei Tagen über 180 Kilometer den Fluß hinunter.
Weitere beliebte Rafting-Destinationen in Peru: Río Mayo und Río Huallaga in Tarapoto im Dschungel, Río Cotahuasi zwischen Ica und Arequipa, Austragungsort des Sportfestivals von Cotahuasi, Río Urubamba im Valle Sagrado, dem Heiligen Tal der Inka, Río Colca mit 300 Stromschnellen entlang einer der tiefsten Schluchten der Welt oder Río Tambopata, der spektakulärste Fluss Perus im gleichnamigen Schutzgebiet. Weitere Informationen unter www.peru.travel/de [druckversion ed 08/2017] / [druckversion artikel] |
|
[art_4] Spanien: Aníbal González - der Gaudí von Sevilla
Die beiden Pistolenschüsse wurden aus kurzer Distanz abgefeuert. Es geschah am kalten Morgen des 9. Januars 1920. Das anvisierte Opfer überlebte das Attentat, es wurde - wie durch ein Wunder - nicht einmal getroffen. Vielleicht haben die Hände des Attentäters gezittert, denn seine Zielscheibe war ein Mensch, der eigentlich keine Feinde hatte und einer der beliebtesten Bürger der Stadt Sevilla: der Architekt Aníbal González y Álvarez Osorio. Das genaue Motiv des Anschlags konnte bis heute nicht geklärt werden. Vermutlich gab es keinen Grund für einen persönlichen Hass auf den Architekten. Aber es waren wirre Zeiten in Spanien, besonders in Sevilla, wo die sozialen Gegensätze und der aus ihnen resultierende Zündstoff so groß waren wie in kaum einer anderen spanischen Stadt. Schon damals lebten hier die reichsten und ärmsten Spanier dicht zusammen. In der ehemaligen Wirtschaftszentrale eines Weltreichs, von dem nach dem verlorenen Krieg gegen die USA 1898 nichts mehr übrig war, trafen zwei Welten aufeinander: glanzvolle andalusische Hochadelsdynastien, die seit dem Mittelalter über endlose Latifundien verfügten und abgeschottet hinter hohen Mauern in ihren Stadtpalästen residierten, und die schmutzig-staubigen Quartiere von Tagelöhnern, Gelegenheitsarbeitern und Zigeunern, die sich irgendwie durchschlagen mussten. Trotz industrieller Revolution und sozialistischer und liberaler Bewegungen herrschte in der Hauptstadt Andalusiens, die den Start ins 20. Jahrhundert verschlafen hatte, weiterhin eine fast feudale Gesellschaftsordnung. Doch unterschwellig schwelten die sozialen Konflikte und brachen immer häufiger und heftiger aus. Die Schatten von Lenin und Bakunin verdunkelten nicht nur Katalonien, sondern auch Andalusien. Spätestens seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts flackerte immer wieder Gewalt auf, die sich gegen die Großgrundbesitzer, das Großbürgertum und die Kirche richtete. Seit seiner Jugend war Aníbal González (geb. 1876) Zeuge solcher Gewaltausbrüche. Vor allem seit der russischen Oktoberrevolution von 1917 erhielt Sevilla den Beinamen "La Roja" (die Rote), denn Attentate gegen Adlige, Plünderungen von Klöstern oder gewalttätige Streiks waren an der Tagesordnung. Und der schöngeistige Architekt Gónzalez Osorio, eigentlich völlig unpolitisch, geriet zwischen die Fronten. Streikende Bauarbeiter und Maurer, die an seiner gigantischen Plaza de España bauen sollten, stellten ihn auf die gleiche Stufe mit den verhassten Aristokraten, für die er neue Stadtpaläste entwarf. Sie verwechselten den Architekten mit seinen Auftraggebern. Nur so lässt sich das Attentat vom 9.1.1920 erklären. Die Reaktionen auf diesen Anschlag waren heftig. Die konservativen spanischen Zeitungen verurteilen ihn als "antispanischen Akt" und behaupteten, der Attentäter (ein anarchistischer Hilfsarbeiter) "könne keinen Tropfen sevillanisches Blut in den Adern haben", dass er es wage, den andalusischsten aller Architekten anzugreifen. Aníbal González selbst war erschüttert über den unerwarteten Hass, der ihm von den vier Verschwörern entgegen schlug, die den gescheiterten Anschlag geplant hatten. Insgesamt aber distanzierten sich auch die meisten linksgerichteten Zeitungen entschieden von dem Attentat. Denn der oft "Dichter-Architekt" genannte Aníbal González, nach dessen Plänen im Stadtpark María Luisa die Prachtbauten für die Ibero-amerikanische Ausstellung 1929 in den Himmel wuchsen, war zu beliebt beim Volk, um ihn als "Volksfeind" anzuprangern.
Aníbal González zitierte in seinen Werken, die schon Zeitgenossen als Gedichte aus Stein bezeichneten, die drei typischsten Baustile Spaniens: Mudéjarstil, Renaissance (in der spanischen Sonderform des estilo plateresco) und hispanischen Barock. Dabei betonte er die Sevillaner Besonderheiten, mit denen diese drei Stile während des Siglo de Oro ausgestaltet wurden. Dies zeigt sich nicht nur im Erscheinungsbild seiner Bauten, die in vielen Details an Sevillaner Paläste oder Kirchtürme des 16. und 17. Jahrhunderts erinnern, sondern auch in der Wahl des Baumaterials. Beim zentralen Gebäude der Ausstellung, dem riesigen spanischen Pavillon der Plaza de España, verwendet er rötliche Ziegelsteine - wie Leonardo de Figueroa, Sevillas großer Barockarchitekt - und viele Elemente aus Keramik (Azulejos, glasierte Dachziegel, Giebelschmuck) sowie kunstvoll geschmiedete Eisengitter. Die Plaza de España (1911 - 1928), das Hauptbeispiel der Architektur von Aníbal González, ist in jeder Hinsicht großartig, nicht nur wegen ihrer kolossalen Dimensionen. Der weite, halbkreisförmige Platz misst 200 Meter im Durchmesser, der spanische Palast, der ihn umarmt, ist einen halben Kilometer lang. Das eigentliche Kunststück bei dieser Konstruktion aus Neorenaissance und Neobarock ist eine selten gelungene Kombination zwischen monumentalen Ausmaßen, praktischer Funktionalität und verspielt-zierlicher Dekoration. Man kann das ganze Gebäude unter schattigen Arkadengängen entlang wandeln, die von schlanken, grazilen Säulen getragen werden, originelle Keramikbrücken schwingen sich über den parallel zum Baukomplex künstlich angelegten Kanal, liebevoll gestaltete Azulejo-Bilder repräsentieren die (damals) 48 spanischen Provinzen. Selten wurde ein Nationaldenkmal konstruiert, das ganz ohne kriegerisches Pathos auskommt und doch mit Stolz die kulturellen Leistungen einer Nation darstellt. Für jede Provinz Spaniens erscheint im weiten Halbkreis eine Landkarte aus Keramikfliesen und jeweils darüber ein zweites Kachelbild, das eine historische Szene zeigt, die sich in jener Provinz abgespielt hat. Abgegrenzt sind die Darstellungen der verschiedenen Provinzen durch Sitzbänke, die ebenfalls mit Azulejos verziert sind. Daneben befindet sich ein Regal aus Keramik, in dem früher Bücher spanischer Klassiker ausgelegt waren. Eine schöne Idee des Architekten, die demonstriert, wie sehr bei der Anlage des Ausstellungsgeländes didaktische Prinzipien eine Rolle spielten. Allerdings wusste auch Aníbal González, dass schriftliche Erklärungen für eine andalusische Bevölkerung, die damals noch zu einem großen Teil aus Analphabeten bestand, weniger wichtig sind als bildliche Darstellungen. Deshalb zog er alle Register der Bebilderung. Bis ins kleinste Detail ist alles durchkomponiert, González schien getrieben vom "horror vacui", der in Andalusien nicht erst seit dem Barock, sondern schon in der arabischen Kunst dominierend war. Denn es gibt an diesem gigantischen Gebäudezirkel kaum eine Fläche ohne Bild oder Verzierung: Keramikintarsien, Säulen und Wappen schmücken die Ziegelfassade, die Holzdecken der Arkaden sind vergoldet und - wie schon in arabischen Bauten üblich - in jedem Abschnitt mit einem anderen Muster versehen. Sogar die Dachziegel sind bunt glasiert und zu geometrischen Figuren angeordnet.
Es ist das Verdienst des Architekten mit der Plaza de España inmitten des María-Luisa Parks einen öffentlichen Raum geschaffen zu haben, der wie eine Bühne für die Bevölkerung Sevillas funktioniert, die diesen Platz begeistert angenommen hat. Und dieser prachtvolle Theaterschauplatz wird auch von großstädtischen Selbstdarstellern gern besucht. Hier ist alles vertreten, von Señoritas, die in Flamenco-Kleidern posieren, gut gebauten Sonnenanbetern, die sich auf den Keramikbänken präsentieren, Hochzeitsgesellschaften, die für ein Foto hierher kommen, Touristen, die in Pferdekutschen den Platz umrunden bis zu den lärmende Kinder, die sich in Tretbooten Wasserschlachten auf dem Kanal liefern. Der Schöpfer dieses Szenarios hätte seine Freude an solchen Bildern, besonders wenn es sich in den Frühlingsmonaten in eine Freilichtbühne für Prozessionen der Semana Santa verwandelt oder sich die Tänzerinnen und Tänzer der Feria de Abril auf dem Weg in die Nacht in Stimmung bringen. Man hat Aníbal González oft den "andalusischen Gaudí" genannt - und in der Tat war er für Sevilla genauso wichtig wie sein großer katalanischer Zeitgenosse für Barcelona. Andererseits werfen einige Kritiker González vor, im Gegensatz zu Gaudí eher konservative, historistische Architektur entworfen zu haben für eine Stadt, die ewig in ihrer goldenen Vergangenheit lebt und sich echten architektonischen Neuerungen verschließt. Es ist zweifellos richtig, dass die Entwürfe des Sevillaner Baumeisters weniger originell waren als die Werke Gaudís. Aber Aníbal González hat etwas geschafft, was fast unmöglich schien. Seine zahlreichen Neubauten - neben den großen Pavillons für die Expo 1929 hat er Hunderte von Häusern für das Stadtzentrum Sevillas entworfen - fügen sich harmonisch ein in das komplizierte Architekturensemble der größten Altstadt Europas. Dadurch, dass er barocke, platereske und mudejare Elemente typisch andalusischer Prägung in seinen Bauten zitiert, nimmt er Rücksicht auf Jahrhunderte lang gewachsene Strukturen. Er hat entscheidend dazu beigetragen, den einzigartigen Zauber Sevillas bis in die heutige Zeit zu retten. In einer Epoche, in der die Moderne Architektur mit allen Traditionen brach und nur noch Glattes und Eckiges gelten ließ, setzt er (darin Gaudí wiederum ähnlich) der beginnenden Diktatur des Würfels seine geballte Romantik entgegen: prachtvolle Azulejo-Bilder, Voluten und verschnörkelter Giebelschmuck verkünden eine Poesie aus Stein. Mit Erfolg! Denn die zeitlose Schönheit seiner Architektur wurde Jahrzehnte lang imitiert und bis heute wird der Stil von Aníbal González gleichgesetzt mit typisch Sevillaner Architektur. Er hat nicht nur ein paar spektakuläre Prestigebauten vollendet, sondern er schuf eine ganze Stadt: er hat Sevilla neu entworfen, seine Werke haben der andalusischen Hauptstadt ein neues Selbstbild gegeben. Neben der Giralda und dem Goldturm ist die Plaza de España zum dritten architektonischen Symbol Sevillas geworden. Auch die Gebäude der Plaza de América haben die Stadt nach Süden hin geöffnet und auch dieser Platz wurde von den Sevillanern in ein Freiluft-Wohnzimmer verwandelt. Hier stehen sich zwei sehr verschiedene Pavillons in einem spannenden Kontrast gegenüber. Der Renaissance-Pavillon, errichtet im neoplateresken Stil (1912 - 1920), diente ursprünglich als Ausstellungsgebäude für die Schönen Künste und beherbergt heute das Archäologische Museum. Er besteht aus fünf rechteckigen Ausstellungshallen, die durch einen Galerie-Riegel miteinander verbunden sind. Dieser Palast wirkt trotz der schnörkeligen Gesimse wuchtiger und weniger verspielt als die übrigen Bauten von González. Ihm gegenüber steht für mich das interessanteste und schönste Werk von Aníbal González: der Pabellón Mudéjar, erbaut zwischen 1912 und 1916. Der Neo-Mudéjarstil dieses Palasts zeigt auch orientalische und fernöstliche Merkmale, wie z.B. die fast an Pagoden erinnernden Obergeschosse der Ecktürme mit ihren geschwungenen Dachgiebeln.
Nach der Eröffnung der Expo 1929 schrieb ein begeisterter Journalist über den Architekten: "Er scheint nicht mit Steinen, sondern mit Rosen zu bauen." Der kleine, unscheinbare Mann, der soviel Schönes für seine Heimatstadt geschaffen hatte und doch so bescheiden war, dass er verbot, ihm ein Denkmal zu setzen, starb nur wenige Tage, nachdem er sein Werk vollendet gesehen hatte, in der Nacht des 31. Mai 1929. Nur drei Wochen zuvor war die Ibero-amerikanische Ausstellung eröffnet worden. Der Glanz dieser Expo und das stolze Gefühl der Sevillaner, nach zwei Jahrhunderten des Vergessens endlich wieder im Rampenlicht der Weltbühne zu stehen, überstrahlten jedoch nur kurz die Rückständigkeit, die fundamentalen Probleme und schwelenden sozialen Konflikte in Sevilla. Nur ein paar Jahre später brachen die Konflikte, die zum Attentat auf Aníbal González geführt hatten, heftiger aus als je zuvor. Zwischen 1932 und 1936 kam es immer wieder zu Streiks und Straßenschlachten, Hunderte von Attentaten wurden verübt, von denen mehr als die Hälfte leider erfolgreicher waren als der Anschlag auf den Architekten, und Dutzende von Kirchen und Klöstern Sevillas wurden von Anarchisten geplündert und in Brand gesteckt. Danach folgte die Lähmung und Friedhofsruhe der Franco-Diktatur. Es sollte bis zur nächsten "Expo", der Weltausstellung 1992, dauern, bis Sevilla endlich - und diesmal offenbar nachhaltig - den Sprung zurück in die Reihe der großen Kulturmetropolen der Welt schaffte, gepaart mit einem dauerhaften wirtschaftlichen Aufschwung und einer vorsichtigen Modernisierung, in der ausreichend Platz ist für den Glanz vergangener Epochen - so wie in der Architektur des Aníbal González. Text + Fotos: Berthold Volberg [druckversion ed 08/2017] / [druckversion artikel] / [archiv: spanien] |
| [kol_1] Hopfiges: Isenbeck (Argentinien) Es steht jetzt direkt vor mir auf dem Tisch. Mittags. Draußen angenehme 25 Grad und hier drinnen noch einmal drei Gard wärmer, aber auszuhalten. Leichter Schweiß an der Schläfe, schließlich bin ich ein wenig gewandert. Neben mir warten exakt sieben goldgelbe Empanadas darauf, endlich verspeist zu werden und gerade knallt mir Kellner Nacho die Flasche Isenbeck auf den Tisch. Eisgekühlt – oben raucht die Flasche sogar noch wunderbar appetitlich. Gut so, schließlich habe ich ja Durst. "Quilmes ist aus", raunt er mir noch zu. Dann bin ich wieder allein mit meinen Empanadas, dem Bier, einem Glas und dem Blick durch die Fensterscheibe auf die Calle Marechal und den Parque Centenario.  Die Sache mit dem "Quilmes ist aus" ist nicht weiter schlimm. Dann könnte sich das Kopfweh später in Grenzen halten. Vielleicht liegt’s nicht mal an dem Bier selber, sondern an meiner körperlichen Konstitution, dass ich kein Bier mehr vertrage, aber beim letzten Mal, ausgerechnet im italienischen Florenz beim Argentinier, habe ich an das blau-weiße Quilmes nicht wirklich die besten Erinnerungen. Jetzt also Isenbeck. Weiß-gelber Hintergrund, rote Lettern, darüber ein Emblem mit schwarzem Reiter. "Cerveza alemana", wie mir Nacho noch einmal versichert. Als ob ich das nicht wüsste. Schließlich steht es hinten irgendwo klein drauf: Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. 1796 steht unter dem schwarzen Reiter. Nicht gelogen, aber eben auf Deutschland, genauer gesagt, Hamm, bezogen, denn daher kommt das Bier ursprünglich. In Argentinien gibt’s den Ableger erst seit 1994. Toll ist die Flasche schon deshalb, weil ich zum ersten Mal genau einen Liter vorgesetzt bekomme und nicht irgendwelche unzulänglichen 960cc. Nicht, dass man mit den vorenthaltenen 40 Millilitern noch Bäume ausreißen könnte, aber man ist das halt so gewohnt. Wie aber schmeckt jetzt dieses Isenbeck? Ordentlich. Ein bisschen, wie es aussieht, nämlich dünn, aber man kann das herbe Gebräu wunderbar trinken. Und das sogar recht fix. Beim Abgang nach den Schinken-Käse-Empanadas wunderbar stimmig, nach der mit Roquefort schmeckt es hingegen noch ein bisschen blasser, aber dann ist die Flasche auch schon leer und man ordert entweder direkt noch eine – schließlich ist es angenehm warm hier drinnen – oder schwenkt auf Isenbeck Bock um. Der ist ein bisschen dunkler, ein bisschen schwerer, ein bisschen mehr Körper, malziger. Theoretisch, denn irgendwie noch immer ein bisschen dünn. Fazit: Als richtig süffig kann man keine der beiden Isenbecks bezeichnen, wohl aber durstlöschend. Vielleicht erwartet man aber auch zu viel von einem deutschen Bier, das in Argentinien gebraut wird. Schließlich gibt’s ja noch wunderbare Weine en masse, die es zu verkosten gilt. Dabei aber kann eben jenes Isenbeck schon mal ein netter Kontrapunkt zum schweren Wein sein. Und das ist doch auch was! Bewertung Isenbeck (Argentinien)
Text + Foto: Andreas Dauerer [druckversion ed 08/2017] / [druckversion artikel] / [archiv: hopfiges] |
|
[kol_2] Erlesen: Barocke Liturgie und deutsche Siedler
Kunstmusik-Kolonialismus-Lateinamerika Anlass für diesen Sammelband zum Thema "Kunstmusik-Kolonialismus-Lateinamerika" waren eine gleichnamige Ringvorlesung an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock sowie der Besuch einer Gruppe von Musikern aus Brasilien im Jahr 2015, die gemeinsam mit Studierenden dieser Hochschule liturgische Musik aus dem Bundesstaat Minas Gerais aufführten.
Im Vorwort beschreibt Barbara Alge, Professorin für Ethno-Musikologie, wie nach einer Aufführung brasilianischer Chorsänger und Musiker mit deutschen Musikern interkulturelle Missverständnisse zu Tage traten: Die liturgische Musik, die auf in Minas Gerais gefundenen Partituren basiert, unterscheidet sich nicht sehr von europäischer Kunstmusik jener Zeit (18. Jahrhundert). Dennoch wurde der Vortrag der Brasilianer in Rostock zum Teil als exotisch wahrgenommen. Die Deutschen änderten Noten in den Partituren des Komponisten Lobo de Mesquita, um Dissonanzen zu vermeiden, die die Brasilianer wiederum gerade als spannungsgeladen empfanden. Außerdem sind die Orchester in Brasilien nicht so standardisiert wie in Deutschland und die Aufführungspraxis liturgischer Kolonialmusik in einer Kirche in Minas Gerais ist eine andere als auf einer deutschen Bühne: Glauben ausdrückende und identitätsstiftende Umgangsmusik wird zur Darbietungsmusik. Diese u.a. Unterschiede führten dazu, dass das deutsche Publikum die Vorstellungen eben als "exotisch" empfand. Erklärungen zu diesem Missverständnis bieten dann einige der folgenden Texte, die sich mit den Partituren, z.B. aus dem Dorf Morro Vermelho in Minas Gerais, beschäftigen. Es wird u.a. die Frage aufgeworfen, welche Aufführungspraxis für diese Musik angemessen ist: die heutige in Brasilien oder diejenige, die sich auf europäische Modelle des 18. Jahrhunderts bezieht? Barbara Alge ist es auch, die in ihrer Einleitung einen kurzen Überblick zur Geschichte der liturgischen Musik in Lateinamerika gibt, die natürlich von europäischen Kapellmeistern in Mexiko-Stadt, Lima oder Bogotá geprägt wurde, mit ihren Vorlieben für Werke von spanischen oder italienischen Komponisten. Auch hier kommt wieder die Aufführungspraxis zur Sprache, in der nach Meinung einiger Musikwissenschaftler das eigentlich "barocke" der liturgischen Musik aus Minas Gerais liegt: dramatische Aufführungen und prunkvolle Feiern in mit Gold überladenen Kirchen. In den beiden wichtigsten Zentren für liturgische Musik, der Escuela de chacao (Venezuela) und der Escola Mineira in Brasilien, durften auch mulatos Musik machen und komponieren, ein wichtiger Aspekt in der Musikvermittlung. Und sie taten es mit größerer Freiheit, da sie nicht den Regeln der Europäer unterworfen waren, und entwickelten so einen einzigartigen Stil, der auch afrikanische Elemente enthielt. Aufgrund der steigenden Nachfrage in den prosperierenden Minen-Städten stieg die Zahl der mulato-Sänger, -Musiker und -Komponisten an, so dass bald eine eigene Klasse entstand. Drei Texte befassen sich denn auch mit der Geschichte, Entwicklung und Verbreitung der (afrikanischen) Tänze chacona und lundu (inkl. der dazugehörigen Musik). Eine - wenn nicht die wichtigste - Rolle für das Musikleben jener Zeit spielten die Jesuiten, die in ihren Reduktionen die indígenas auch in Musik unterrichteten, wie Marcus Holler in seinem Beitrag berichtet. Die Kontaktaufnahme der Mönche erfolgte über die indigenen Kinder, die mit Musik zu begeistern waren. Die Jesuiten übersetzten auch viele (Lied)Texte ins Guaraní und andere indigene Sprachen, und sorgten so dafür, dass durch diese Musikausbildung der indigenen Bevölkerung sich europäische und indigene Musikpraktiken vermischten, ein bis heute wichtiger Einfluss. Außerdem bilden ihre Musikdokumentation die einzige Quelle zu diesem Thema vor dem Jahr 1759. Zum Schluss befasst sich ein Beitrag mit den deutschen Einwanderern im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina. Ihre Migrationsgeschichte ist bereits breit erforscht worden, ihr kultureller Einfluss ist ebenfalls Gegenstand einiger Forschungsprojekte, aber im Bereich der Musik ist es vor allem die Volksmusik, die dort behandelt wird, da sie in vielen Gemeinden immer noch gepflegt wird. Kunstmusikalische Aktivitäten, wie sie Christian Storch versucht in den Mittelpunkt zu stellen, wurden bisher kaum erforscht. Die Deutschen kamen in Gebiete, die schon zu einem anderen Staat gehörten, waren also keine Eroberer. Und Brasilien war – auch musikalisch – bis 1889 stark von Portugal abhängig bzw. geprägt, trotz großer Einwanderergruppen aus Italien, Japan und eben dem deutschsprachigen Raum. Die Einwanderer bildeten kulturell nahezu geschlossene Gruppen: Je größer ihre Siedlungen wurden, desto vielfältiger entwickelte sich das kulturelle und Vereinsleben, das (Männer)Gesangsvereine, Laienmusikgruppen und Theaterkompanien umfasste. Bei den Gesangsvereinen lag der Schwerpunkt auf volksmusikalischen Gesängen, wie aufgefundene Liederbücher belegen. Aber auch Storch muss eingestehen, dass die Forschungen erst am Beginn stehen, weswegen man als Leser dieses Textes mit einer Mischung aus Neugier und Frustration zurückbleibt. Dieser Sammelband ist vor allem für Musikwissenschaftler interessant, aber auch für Interessierte an der Kulturgeschichte Brasiliens, in die er einige neue Einblicke eröffnet. Text: Torsten Eßer Cover: amazon [druckversion ed 08/2017] / [druckversion artikel] / [archiv: erlesen] |
|
[kol_3] Sehen: Nicaragua, Fluch der Langustentaucher
360° Geo Reportage Die Angehörigen des indigenen Volkes der Miskito an der Küste Nicaraguas sind begnadete Taucher. Um an die wertvollen Karibischen Langusten zu kommen, tauchen sie bis zu 40 Meter tief und das bis zu 15 Mal am Tag. Dabei ist ihre mangelhafte Ausrüstung kaum für seichte Gewässer ausgelegt. Seit Jahren wird über ein Tauchverbot debattiert. Doch dagegen wehren sich die Miskito, das Tauchen ist ihre Lebensgrundlage. „360° Geo Reportage“ begleitet sie auf ihren vielleicht letzten Tauchgängen und zeigt einen jungen Amerikaner, der versucht, verletzten Tauchern zu helfen.
Sendetermine Montag, 7. August 2017 um 11.20 Uhr | ARTE Samstag, 12. August 2017 um 08.45 Uhr | ARTE Du findest den Film nach der Ausstrahlung in der ARTE-Mediathek. Online von 07. August bis 14. August Moncado McCanley und sein Sohn, Angehörige des indigenen Volkes der Miskito, bereiten sich für einen Tauchgang vor. Wie die meisten der Langustentaucher in Nicaragua haben die beiden kein eigenes Boot. Stattdessen heuern sie auf einem großen Industrieboot an, das in den nächsten zwei Wochen Hunderte Langusten fangen will. An der Miskitoküste im Osten Nicaraguas ist das der einzige Job – und ein gut bezahlter dazu.
Doch die Männer riskieren bei jedem Tauchgang ihr Leben. Ihre Ausrüstung aus kaputten Atemschläuchen, verrosteten Dichtungen und Pressluftflaschen ohne Druckanzeige ist oft uralt. In den letzten Jahren sind unzählige Taucher verunglückt oder erlitten die gefährliche Taucherkrankheit. Diese tritt auf, wenn ein Taucher nicht genug Zeit zum langsamen Auftauchen hat. Lebenslange Behinderungen oder gar der Tod sind die Folgen. Die einzige Chance, die Taucherkrankheit ohne Schäden zu überstehen, ist die schnelle Behandlung in einer Dekompressionskammer. Allerdings gibt es davon nur eine einzige an der ganzen Ostküste. Sie kam vor Jahren über eine private Hilfsorganisation aus Miami und hat bereits etlichen Tauchern das Leben gerettet.
Leiter der Organisation ist der Amerikaner Joshua Izdepski. Er inspiziert das Krankenhaus von Puerto Cabezas, besucht kranke Taucher in den Dörfern und macht sich auf den Booten ein Bild vom unzureichenden Tauchequipment der Miskito.
Wegen eines angeblichen Schutzes der Miskito wird seit Jahren über ein Tauchverbot debattiert – doch dagegen wehren sie sich. Das Tauchen und Fangen der weltweit begehrten Karibischen Langusten ist ihre einzige Einkommensquelle. Text: ARTE [druckversion ed 08/2017] / [druckversion artikel] |
|
[kol_4] Lauschrausch: La Migra und die Valle Cousins
Irakere lässt grüßen: Der erste Track auf dem Album "La migra" (Einwanderungspolizei) der in Toronto beheimateten Band Battles of Santiago klingt stark nach der kubanischen Band aus den 70er Jahren, die als erste die Gesänge und Trommeln der Santería-Zeremonien in die Musik, den Jazz holte. Kein Wunder, denn der funkrockige Titel, sieben Minuten lang, ist Oggun gewidmet, dem Orisha des Krieges und der Kraft. Während der zweite Titel, eine Endlosschleife gleicher Klänge und Rhythmen, nur nervt (er soll wohl den tranceartigen Charakter der Zeremonien versinnbildlichen), geht es für den Rest des Albums wieder bergauf: "Pa‘ bailar" und "Congo" steigen perkussiv und schnell und mit breiter Instrumentierung in den Latin-Jazz- bzw. Hardrock ein, während "Cimarron" - auch unter Latinrock abzulegen - im Rap-Gesang das Thema des entflohenen Sklaven, der ein freies Leben beginnt, aufgreift. Mit "El viaje del bata" holen die Musiker aus Kanada und Kuba heilige Trommeln in ihre Musik, die dann wieder zu Ehren des Schicksalsgottes Elleggua erklingen ("Barasu-Ayo"), dessen gute und böse Seite in getrennten Tracks behandelt werden. Funky klingt "Se me complica" nach dem das Album mit "Bomba grande", mit sehr markanten Saxophonsoli, im Bomba-Rhythmus (Puerto Rico) ausklingt. Energetisch, mitreißend, tanzbar. Empfehlenswert! Der Schriftsteller Leonardo Padura nennt dieses Album ein "Juwel" und trifft damit ins Schwarze. Es ist für die Hörer ein Glücksfall, dass sich diese beiden Cousins, deren musikalische Karrieren so unterschiedlich verliefen, wieder getroffen und entschlossen haben, gemeinsam zu musizieren. Schon als Teenager hatten sie mal im Wohnzimmer von Orlandos Familie in Havanna zusammen gejamt, aber dann trennten sich ihre Wege: beide absolvierten zwar ein klassisches Musikstudium, Ramón wandte sich aber früh dem Jazz zu, während Orlando noch Erfahrungen in populären kubanischen Bands sammelte, bevor auch er sein Spektrum auf den Jazz ausdehnte (u.a. bei Irakere). Dann übersiedelte Ramón nach Europa, wo er mit europäischen Musikern spielte, aber auch seinen Wurzeln nachspürte und die traditionelle Musik in sein Programm / seine Kompositionen aufnahm. Auf "The art of two" fließen all‘ diese Erfahrungen als Synthese aus afro-kubanischer Musik, Jazz und Kammermusik in die wunderschönen Melodien und wechselnden Rhythmen ein, sei es in den Balladen "Johana" und "Alena", die weiblichen Familienmitgliedern gewidmet sind oder im "flotten" Latinjazztitel "Latin for two". Selbst in den melancholischen Passagen steckt noch karibische Freude, meistens versteckt in Orlandos virtuosem Flötenspiel, während das klare Spiel von Ramón manchmal an Keith Jarrett erinnert. Zu den sieben Eigenkompositionen kommen drei traditionelle kubanische Titel hinzu, von denen nur "Tú mi delirio" von Cesar Portillo de la Luz ein echter Klassiker ist. Text: Torsten Eßer |
.