

|
spanien: Évora – Museumsstadt im Alentejo
BERTHOLD VOLBERG |
[art. 1] |
|
bolivien: Inti Wara Yassi - Boliviens Arche
KATHARINA NICKOLEIT |
[art. 2] |
|
brasilien: Das Maß aller Dinge - Belgien
THOMAS MILZ |
[art. 3] |
|
argentinien: Durch den schönen Norden – Teil 2
ANDREAS DAUERER |
[art. 4] |
|
amor: Kleine Mystik für deutsche Auswanderer
NIL THRABY |
[kol. 1] |
|
grenzfall: Das Schwein von Aloria
BIRGIT SCHÖNAUER |
[kol. 2] |
|
helden brasiliens: Senhor Claude revisited
THOMAS MILZ |
[kol. 3] |
|
macht laune: Al baño
DIRK KLAIBER |
[kol. 4] |
|
[art_1] Portugal: Die "Invasion" der Jesuiten in Äthiopien
Pedro Paez "bekehrt" 1620 Kaiser Susinios III. Im Jahr 2003 versammelt sich eine spanische Reisegruppe am Tana-See in Äthiopien, unweit der Quellen des Blauen Nils in der ehemaligen Hauptstadt Gorgora um einen halb verwitterten Grabstein, der in einer Kirchenruine steht. Inzwischen ist der Grabstein vom Unkraut befreit und restauriert und zu Ehren des Toten, an den er erinnert, wurde eine Gedenktafel in spanischer und amharischer Sprache angebracht - anlässlich des 400. Jahrestags seiner Ankunft in Äthiopien (1603). Die Reisegruppe, deren Expedition 2003 unter anderem von der Tageszeitung "El Mundo" gesponsert worden war, folgte den Spuren des in Europa weitgehend vergessenen spanischen Missionars Pedro Paez. Inspiriert durch sein Leben und Werk publizierte der spanische Bestseller-Autor Javier Reverte 2001 seinen Roman mit dem Titel: "Dios El Diablo y La Aventura" (Gott, der Teufel und das Abenteuer). Mit dem Erfolg dieses Romans dürften die Impressionen des Jesuiten Pedro Paez vor der Vergessenheit bewahrt werden.
Pedro Paez wurde 1564 in einem kastilischen Dorf mit dem schönen Namen Olmedo de las Cebollas in ein Ambiente hineingeboren, das nicht gerade eine glänzende Zukunft erahnen ließ. Doch nachdem er 1582 mit nur 18 Jahren dem Jesuitenorden beigetreten war und einige Jahre im portugiesischen Coimbra studiert hatte, bat er darum, zur "Heidenmission" nach Asien gehen zu dürfen. Von diesem Wendepunkt an entwickelt sich sein Leben zu einer idealen Romanvorlage und er sollte nie mehr nach Europa zurückkehren. 1588 erreicht er zunächst Goa. Diese indische Hafenstadt war seit 1510 portugiesische Kolonie und Sprungbrett für alle Expeditionen der Krone Portugals in Asien und Ostafrika und Ausgangspunkt für Missionsaktivitäten. Auch die Jesuiten gründeten ein Kloster in Goa um von dort aus Gebiete in Indien, China, Japan und Ostafrika zu missionieren. Nach etwa einem Jahr macht sich Pedro Paez auf den Weg nach Äthiopien. Unterwegs wird er von Arabern gefangen genommen und als Sklave verkauft. In einer Sklavenkarawane, zu Fuß und in Ketten, durchquert er als erster Europäer die Wüste Hadramaut im Jemen und verbringt viel Zeit in unterirdischen Kerkern, wie er später berichtet. Insgesamt sieben Jahre dauert seine qualvolle Gefangenschaft, die er dazu nutzt fließemd Arabisch zu lernen. Dann wird er freigekauft, erholt sich einige Zeit in Goa, bevor er erneut aufbricht und 1603 endlich Äthiopien erreicht. Er bleibt in der Nähe der Küstenstadt Massawa und lernt eifrig die äthiopische Landessprache Amharisch sowie die Kirchensprache Geez, das "äthiopische Latein", bevor er sich an den kaiserlichen Hof nach Gorgora am Tana-See begibt. Überraschend schnell gewinnt er die Freundschaft des Negus Negusti ("König der Könige"), wie sich die Kaiser Äthiopiens seit Jahrhunderten nannten. Kaiser Za-Dengel ist fasziniert von diesem seltsamen Fremdling, der seine Sprache perfekt spricht und einen sehr weiten Weg zurück gelegt hat, nur weil er sich gern mit ihm über Gott, die Heilige Schrift und den Papst unterhalten möchte.
Warum war Paez in dieses entlegene Land gekommen, das er bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen würde? Und was bedeutete sein Zusammentreffen mit dem Kaiser vor dem Hintergrund der langen Geschichte Äthiopiens? Für die Europäer der frühen Neuzeit, die erstaunlich wenig über diesen Teil der Welt wussten, war Äthiopien das sagenumwobene Land des "Priesters Johannes" - so wird es von vielen portugiesischen und spanischen Entdeckern genannt. Man glaubte, dass diese geheimnisumwitterte Gebirgsregion im östlichen Afrika von einem Priesterkönig regiert würde. Und so falsch war diese Idee nicht. Denn obwohl die orthodoxe Kirche Äthiopiens nominell abhängig war vom Patriarchen im ägyptischen Alexandria, der wiederum den äthiopischen Patriarchen ernannte, entwickelte sie sich de facto spätestens seit der Zagwe-Dynastie im 12. Jahrhundert unabhängig. Oft waren die Kaiser im Falle eines schwachen Patriarchen auch die eigentlichen Führer der Kirche - und viele von ihnen trugen tatsächlich den Namen Johannes. Pedro Paez berichtet in seinen Schriften von der Geschichte Äthiopiens und dem Gründungsmythos des Kaiserhauses, wobei er sich auf die Chroniken der Herrscher ("Kebra Naghast") bezieht. Alles begann der Legende nach tausend Jahre vor Christus mit der Liebe zwischen dem israelitischen König Salomon und der Königin von Saba, die aus Äthiopien kam. Alle äthiopischen Kaiser führten ihre Dynastien zurück auf die Nachkommenschaft von Salomon und der Königin von Saba (wobei keineswegs klar ist, ob es überhaupt zu einer Vereinigung der beiden kam - das Alte Testament bleibt hier unklar und lässt viel Spielraum für Interpretation). Und noch der letzte Kaiser Äthiopiens, RasTafari, der später offiziell Haile Selassie hieß, schmückte sich mit dem Beinamen "der Löwe von Juda". Es muss schon vor unserer Zeitrechnung enge Beziehungen zwischen Äthiopien und Israel gegeben haben, denn man pflegt im abessinischen Hochland bis heute erstaunlich viele jüdische Traditionen.
Seit Kaiser Ezana im 4. Jahrhundert zum Christentum übertrat, gilt Äthiopien - zusammen mit Armenien - als ältester christlicher Staat der Welt. Aber das äthiopische Christentum hat auch zahlreiche jüdische Elemente bewahrt, z.B. die Beschneidung, die Feier des Sabbats, Speise- und Fastengebote (Verbot von Schweinefleisch). Gegen Ende des 12. Jahrhunderts entstand während der Regierungszeit des Kaisers Lalibela an dem heute nach ihm benannten, einsamen Ort in 2800 Metern Höhe das "schwarze Jerusalem": die zwölf berühmten Felsenkirchen von Lalibela. Seit 1978 Weltkulturerbe, wurden sie gebaut als ein Abbild des Jerusalemer Tempels - wie man sich ihn in Äthiopien vorstellte - und durch einen gewaltigen architektonischen Kraftakt aus den Felsen gemeißelt. Der portugiesische Jesuit Francisco Alvarez war im 16. Jahrhundert so erstaunt angesichts dieses Architekturwunders, dass er es mit der Kathedrale von Santiago de Compostela verglich und behauptete, es müssten wohl Weiße gewesen sein, die dies gebaut hätten - den Bewohnern des schwarzen Kaiserreichs traute er dies nicht zu.
Kontakte Äthiopiens zum christlichen Europa gab es verstärkt seit dem 15. Jahrhundert, nachdem Kaiser Zara Yacob (1434 – 1468), motiviert durch die islamische Bedrohung, die u.a. vom expandierenden Osmanischen Reich ausging, eine offizielle Bitte um militärische Hilfe an Portugal richtet. Es sollte Jahrzehnte dauern bis eine nennenswerte Reaktion aus Portugal erfolgte und der Kaiser selbst erlebte es nicht mehr. 1520 traf ein portugiesisches Schiff mit Soldaten und Missionaren ein und 1541 eilt Cristovao da Gama, der Sohn des Admirals und Entdeckers Vasco da Gama, den Äthiopiern gegen die Moslems zur Hilfe. Zunächst jedoch ohne Erfolg, denn die muslimische Invasion scheint voran zu kommen und Cristovao da Gama stirbt in der Schlacht. Aber zwei Jahre später werden die Moslems besiegt und wieder aus dem äthiopischen Hochland verdrängt. Parallel zur halbherzigen Waffenhilfe entwickelten die Portugiesen - und Hand in Hand mit ihnen die Spanier (1580 - 1640 wurden Spanien und Portugal in Personalunion von den spanischen Habsburgern regiert) - noch andere, höchst interessante Aktivitäten im Kaiserreich Äthiopien. Etwa ein Jahrhundert lang, von 1520 - 1620, gaben sich iberische Missionare verschiedener Orden in den kaiserlichen Residenzen rund um den Tana-See die Klinke in die Hand - mit dem abenteuerlichen Ziel, das äthiopisch orthodoxe Kaiserhaus in ein römisch-katholisches zu verwandeln. Besonders hartnäckig wurde dieses Projekt von den Jesuiten verfolgt. Die ersten von ihnen, Vorgänger von Pedro Paez, kamen 1557 ins Land.
Nicht bekannt ist, wer den Auftrag zu den Missionen erteilte: König Philipp II. (1556 - 1598), Herrscher von Spanien und Portugal und bekannt für seinen Missionseifer, oder der Papst in Rom. Offenbar hatten beide, der Pontifex Maximus und Seine Allerkatholischste Majestät - ein nahe liegendes Interesse an einem katholischen Äthiopien. Jedenfalls war es ein Beispiel für europäische Arroganz, ausgerechnet das älteste christliche Land "missionieren" zu wollen, um den Einflussbereich des römischen Papstes auszuweiten. Christus hätte es wohl lieber gesehen, dass sich in jenen Tagen äthiopische Missionare auf den Weg ins dekadente Europa machten, wo sich machtgierige Päpste wie Klemens VIII. oder Paul V. mit mehr Hingabe der Eintreibung von Ablassgeldern oder der Versorgung ihrer Neffen mit Kardinalswürden widmeten, als sich um Glaubensfragen zu kümmern. Pedro Paez vertritt im fernen Äthiopien zweifellos auch katholische Missionsabsichten und führt zahlreiche theologische Diskussionen mit Kaiser Za-Dengel, mit dem er Freundschaft schließt. Und er hat Erfolg: 1604 konvertiert der Kaiser offiziell zum Katholizismus. Aber noch im gleichen Jahr wird er während einer Rebellion getötet. Dieser Widerstand war vom äthiopischen Patriarchen unterstützt worden, der seinen Kaiser nun plötzlich als Ketzer verdammte. Denn für den "Abuna Salama" ("Vater des Friedens") - so der Titel der äthiopischen Kirchenführer - war der Übertritt zum Glauben des dahergelaufenen Fremdlings ein skandalöser Affront und ein plötzlich katholischer Kaiser eine Gefahr für das ganze Land. Dennoch ist Pedro Paez als historische Person differenzierter zu beurteilen und verdient Respekt. Denn erstens symbolisiert er nicht nur die eher "negativen" Eigenschaften der Jesuiten (kritiklose Papsttreue und katholischer Universalanspruch), sondern er steht auch für die "positiven" Merkmale dieses Ordens: ein hohes Bildungsideal, Offenheit für fremde Kulturen und Synkretismus, der katholische und einheimische Traditionen zu vereinigen sucht.
Und zweitens interessierte er sich wirklich für das Land, das seine zweite Heimat wurde, und widmete ihm voller Bewunderung seine monumentale, tausend Seiten lange "Historia geral de Etiopia", die leider als unveröffentlicht gelten kann. Das Schicksal dieses so fundamentalen Werkes der Historiographie ist ein Trauerspiel, denn die einzige Ausgabe von 1945 mit winziger Auflage ist längst vergriffen und es gibt nur noch ein halbes Dutzend Exemplare, die in dunklen Ecken portugiesischer Archive dahin dümpeln. Es gibt bis heute weder eine spanische noch eine amharische Übersetzung. Dabei wäre es für die Äthiopier des 21. Jahrhunderts interessant zu lesen, was ein spanischer Mönch in portugiesischer Sprache vor 400 Jahren über ihr Land geschrieben hat. Für die Europäer des 17. Jahrhunderts müssen seine Schilderungen höchst spannend gewesen sein. Denn der Jesuit Pedro Paez sammelt Eindrücke aus einem exotischen Land, die vor ihm noch niemand aus dem Abendland in Worte gefasst hatte. Dieser Abenteurer Gottes entdeckt bei einem Ausflug mit dem Kaiser als erster Europäer 1618 die Quellen des Blauen Nils. Er beschreibt seine Gefühle angesichts der Nilquellen mit den Worten: "Ich gebe zu, dass es mich sehr freute, etwas erblicken zu dürfen, das der König Kyros, der große Alexander und Julius Caesar (vergeblich) zu sehen wünschten." Aber Pedro Paez macht eine für den Rest der Welt vielleicht noch wichtigere Entdeckung. Er berichtet - wahrscheinlich als erster Europäer - über das obskure Getränk, das ihm heiß serviert wird und seine Sinne stimuliert: Kaffee! Trotz der Fülle von Eindrücken vergisst der Entdecker, Architekt (er baute mehrere Kirchen in Gorgora) und Historiker Paez nicht seine Hauptaufgabe. Auch mit Kaiser Susinios (Susneyos) III., der von 1607 - 1632 regiert, führt er lange theologische Gespräche. Dabei scheint jedoch sein Missionseifer immer mehr hinter einem echten religiösen Dialog zurück zu treten, der eher eine Union der beiden Kirchen anstrebt statt römische Missionierung. Und als der Kaiser ihm sagt, er wolle offiziell katholisch werden, gibt Paez ihm den Rat, damit zu warten, um nicht erneut einen Bürgerkrieg zu provozieren.
Am 20. Mai 1622 stirbt Pedro Paez unerwartet an einem Fieber - ein Jahr, nachdem Kaiser Susinios entgegen seinem Rat den Übertritt zum katholischen Glauben verkündet hatte. Die portugiesischen Nachfolger dieses außergewöhnlichen Missionars, die von nun an Einfluss auf den zweiten katholischen Kaiser ausübten, waren weniger tolerant als Paez. Der Jesuit Alphonsus Mendez will viele einheimische Traditionen verbieten, alle Einwohner neu taufen lassen und er lässt sich selbst zum neuen Patriarchen Äthiopiens ausrufen! Von 1622 - 1632 ist also nominell ein Jesuit äthiopischer Kirchenführer. Neben dem Habsburger Ferdinand II. wird Susinios III. der zweite katholische Kaiser der Welt. Es kommt erneut zu einem bürgerkriegsähnlichen Chaos, bis der Kaiser 1632 ein Einsehen hat und zugunsten seines Sohnes Fasildas abdankt. Der neue Kaiser macht kurzen Prozess und beendet abrupt das jesuitische Intermezzo: alle Jesuiten werden aus Äthiopien vertrieben, fünf von ihnen exekutiert. Während seiner langen Regierungszeit 1632 - 1668 lässt er ab 1636 die neue Hauptstadt Gondar aufbauen. Hier zeigt sich, dass die lange Präsenz der Jesuiten auch Vorteile hatte, denn Architekten, die von den Jesuiten ausgebildet worden waren, bauen die Kaiserpaläste von Gondar, die heute eine Touristenattraktion sind und in der Tat nicht sehr afrikanisch, sondern eher wie eine portugiesische Burg in Braga oder Evora aussehen.
Diese architektonische Bereicherung ändert jedoch nichts daran, dass seit der "jesuitischen Invasion" in Äthiopien ein tiefes Misstrauen gegenüber allen europäischen Einflüssen herrscht. Vielleicht hat dies sogar dazu beigetragen, dass das Kaiserreich als einziger Staat Afrikas nie europäische Kolonie wurde. Diese Gefahr wurde noch fast drei Jahrhunderte später von Kaiser Menelik II. abgewendet, der 1896 in der Schlacht von Adua die Italiener vernichtend besiegte - es war der erste und einzige Sieg eines afrikanischen Heeres gegen Europäer im 19. Jahrhundert. Das Kaiserreich Äthiopien fand mit der Ermordung des von der Rastafari-Bewegung als Messias verehrten letzten Kaisers Haile Selassie 1975 durch die sozialistischen Militärdiktatoren ein ruhmloses Ende.
Doch die Geschichte des Landes und seiner unabhängigen Kirche bleiben faszinierend. Und man darf hoffen, dass das monumentale Werk von Pedro Paez, das viel zum Verständnis von Äthiopien beiträgt, endlich neu veröffentlicht und übersetzt wird. Text + Fotos: Berthold Volberg |
|
[art_2] Bolivien: Inti Wara Yassi - Boliviens Arche
In einem von Freiwilligen getragenen Projekt in Bolivien werden gefangene und misshandelte Wildtiere rehabilitiert und ausgewildert. Ein Polizist kommt den kleinen Pfad, der durch dichtes Dschungelgrün führt, herauf. Nach einer kurzen Begrüßung greift er vorsichtig in die Jackentasche, holt eine kleine Pelzkugel heraus und übergibt sie Nena. Die Bolivianerin seufzt und dankt. "Fast täglich bringt uns die Polizei neue Tiere, die sie irgendwo beschlagnahmt haben. Wir sind froh über jedes Tier, das gerettet wird, aber wir wissen schon lange nicht mehr, wie wir das bezahlen sollen", erzählt die 30-jährige, während sie sorgfältig das kleine Tier untersucht. "Ein nachtaktives Äffchen, etwa zwei Wochen alt", stellt sie fest und ruft nach Philip.
Auf einer Reise durch Bolivien hatte er einige Affen aus der Gefangenschaft frei gekauft. In Villa Tunari, einem Städtchen mitten im berüchtigten Chapare, dem Cocaanbaugebiet Boliviens, fand er 1992 das geeignete Areal um sein Refugium für misshandelte Wildtiere zu errichten. Es ist ein idyllischer Ort: Affen turnen durch die Baumwipfel, im satten Grün sitzen bunte Papageien, ein Bächlein plätschert. "Unser Ziel ist es, die Tiere auszuwildern. Aber oft ist das unmöglich, gerade bei den Affen. Wenn sie einmal an Menschen gewöhnt sind, kann man sie nicht einfach aussetzten". Wie zum Beweis turnt ein Spinnenaffe heran und nimmt auf Carlos’ Kopf Platz. "Das ist Pedro, der seine täglichen Streicheleinheiten einfordert", erklärt Carlos ungerührt, und beginnt den großen schwarzen Affen zu kraulen. Vorsichtig überreicht Nena Philip das gerade eingelieferte Äffchen. Der hat schon ein winziges Fläschchen Milch bereit und schiebt den kleinen Gummisauger behutsam in das Mäulchen. Hungrig fängt das Tier an zu saugen. Alle sind erleichtert: Solange die Tiere Hunger haben, haben sie eine gute Chance durch zu kommen. Nachdem sich das Affenbaby satt getrunken hat, setzt Philip es sich auf den Kopf, wo es sich sofort in seinen länglichen Haaren festkrallt und einschläft – so wie es sich am Rücken seiner Mutter festhielt, bevor diese getötet und das Äffchen an Tierhändler verkauft wurde. Philip wird es die nächsten Wochen ständig mit sich herum tragen. Der blonde 20-jährige ist kein Tierpfleger. Er ist nicht einmal Bolivianer. Philip ist Engländer, der sich ein halbes Jahr von der Uni frei genommen hatte um mit dem Rucksack durch Südamerika zu reisen. Nach sechs Wochen landete er in Bolivien bei Inti Wara Yassi. Schnell beschloss er, Machu Picchu und Rio sausen zu lassen und stattdessen den Rest seiner Reisezeit in den Dienst der Tiere zu stellen. So wie ihm geht es vielen Reisenden und ohne die freiwilligen Helfer aus aller Welt wäre das Projekt undenkbar. "Wir sind darauf angewiesen, dass uns Menschen mit ihrer Arbeitskraft unterstützen", erklärt Nena, die das Refugium managed. Die Arbeit ist hart: Käfige säubern, Verschläge bauen, Touristen rumführen, mit Katzen spazieren gehen. Ja richtig, mit den Katzen spazieren gehen. El Gato wartet schon ungeduldig auf seinen Auslauf. Der Puma wurde aus einem Zirkus befreit. Sein Dompteur hat ihn so heftig auf die Hinterläufe geschlagen, dass er nie wieder jagen kann. Ihn auszuwildern ist somit unmöglich. Die Philosophie des Projektes ist es, jedem einzelnen Tier soviel Freiheit wie irgend möglich zu geben.
Der Handel mit Wildtieren hat weltweit ein Volumen von jährlich fünf Milliarden US Dollar. Um ein seltenes Tier zu besitzen, sind Sammler aus Nordamerika und Europa bereit, jeden Preis zu bezahlen. Dazu kommt, dass viele Bolivianer Wildtiere als Haustiere halten. Die Geschichte ist immer dieselbe: Die Mütter werden erschossen, die Jungtiere der oft vom Aussterben bedrohten Arten verkauft. Wenn sie durch kommen, erwartet sie ein jämmerliches Leben in Gefangenschaft. Bolivien hat zwar das internationale Abkommen, das den Handel mit Wildtieren verbietet, unterzeichnet, doch das bitterarme Land hat dringendere Probleme als verwaiste Affen und Papageien mit gestutzten Flügeln. So bringen die Ordnungshüter zwar Tiere, die sie auffinden, nach Villa Tunari in das Auswilderungsprojekt, aber wie Nena und ihre Crew dann für diese Tiere sorgen, ist einzig ihre Sache; vom Bolivianischen Staat gibt es keinen Cent. Getragen wird das Projekt von den Spenden der Freiwilligen und den Eintrittsgeldern der Besucher. Kein Wunder, dass ständig Geldknappheit herrscht. Manche Dinge werden sich wohl nie finanzieren lassen, wie etwa die Idee den Jaguar Juan auszuwildern. Eine reiche bolivianische Familie hatte ihn bei Wilderern bestellt. Die töteten die Mutter und brachten das niedliche Baby in ein schickes Appartement in Santa Cruz. Irgendwann stellte die Familie fest, dass sich der junge, unternehmungslustige Jaguar nicht mit den Designermöbeln vertrug und verkaufte das Tier an einen Zirkus. Die Polizei bekam Wind davon und brachte ihn in das Projekt. Abseits vom üblichen Betrieb, so dass Juan sich möglichst nicht noch mehr an Menschen gewöhnt, brachte man ihm bei zu jagen, so gut das halt geht.
Ja, es ist frustrierend, wenn Nena und Carlos wieder nicht wissen, wie sie das Fleisch für die Wildkatzen, das Holz für die Verschläge, die Kosten für den Tierarzt bezahlen sollen. Aber es gibt auch Erfolgserlebnisse. Papageien, deren Schwungfedern nachwuchsen, ziehen heute im Wald ihre Jungen auf. Eine Gruppe von Affen lebt inzwischen fast völlig autark im benachbarten Regenwald. Selbst ein Puma konnte ausgewildert werden. Und manche Momente, die möchte Nena niemals missen. "Lisa, ein Kappuzineräffchen, kam völlig verwahrlost und verängstigt zu uns. Ihr ganzes Leben hatte sie in einem kleinen Käfig oder an einer kurzen Kette verbracht. Jetzt schwingt sie sich von Ast zu Ast und wurde letzte Woche Mutter. Wenn ich so etwas erlebe, dann weiß ich, dass unsere Arbeit hier nicht umsonst ist." Zufrieden sieht sie dem gelben Äffchen zu, das ein winziges Baby auf dem Rücken trägt. Mehr Informationen über das Projekt gibt es unter www.intiwarayassi.org. Text + Fotos: Katharina Nickoleit
|
|
[art_3] Brasilien: Das Maß aller Dinge - Belgien
Wenn in Brasilien über die Zerstörung des Regenwaldes berichtet wird, schleicht sich auf seltsamen Wegen immer wieder ein kleines europäisches Land in den Kontext: Belgien. Meist geht es darum, die im letzten Jahr abgeholzte Fläche mit der Größe Belgiens zu vergleichen. Erst vor wenigen Tagen konnte der interessierte Leser in der Folha de S. Paulo erfahren, dass "Der Bundesstaat Mato Grosso noch zwei Belgien verlieren wird". Die Fläche von 70.000 Quadratkilometer, die in den nächsten Jahren abgeholzt wird, entspreche mehr als der doppelten Größe des Beneluxstaates. Nun, wie reagiert man in Brasilien, wenn man mit solch einer Nachricht konfrontiert wird? Ich frage meinen brasilianischen Mitbewohner, der schon ausgiebig durch die Welt gereist ist und weiß, dass Flamengo oder Flämisch, nicht bloß ein Fußballclub aus Rio ist, sondern dass man es auch in Belgien spricht, was ihm einfällt, wenn man ihm vollkommen unvorbereitet das Wort "Belgien" entgegenbellt.
Geht es dem um den brasilianischen Regenwald besorgten Journalisten etwa darum, seine Landsleute mit der grauenhaften Assoziationskette wachzurütteln, dass im Amazonasgebiet das Äquivalent ganzer Straßenreihen toller alter Gebäude abgerissen wird, dass eine Jahrhunderte, ja Jahrtausende alte Kultur einfach so per Motorsäge zerstückelt wird, um Viehherden und Sojafeldern Platz zu machen? Eine grausame Umkehr der Evolutionskette? Schon kommt einem "(Nothing but) Flowers" von den Talking Heads in den Sinn: "The highways and cars were sacrificed for agriculture" und dann erst der Refrain "This was a discount store, now it`s turned into a cornfield"! Immerhin kennen viele Brasilianer den Flughafen von Brüssel, der ein beliebter Umsteigeplatz unzähliger Europareisen ist. Klar, dass es bei diesen Menschen größte Bestürzung auslöst, wenn sie lesen, dass der auf dem teuren Flugticket abgedruckte Ziel- oder Transferflughafen von nomadisierenden Bauerntrupps einfach so und bei jeder Gelegenheit gleich mehrfach abgefackelt wird.
Okay, immerhin hat es 30.510 Quadratkilometer. Aber warum nimmt man zur Abwechslung nicht mal das nette Bhutan, das mit 47.000 Quadratkilometern mehr als 50% größer ist, und dokumentiert, dass die demnächst abgeholzte Fläche nahezu die doppelte Fläche Bhutans ausmacht? Wäre den Menschen die drastische Verschlimmerung der Situation klar, die die Wahl Bhutans anstelle Belgiens impliziert? "Leute, bisher ging es immer nur um das kleine Belgien. Aber jetzt hat es mittlerweile schon die bedrohlichen Ausmaße Bhutans angenommen. Wir müssen handeln." Außerdem würde man mit dieser Wahl die Alliterationskette aufrechterhalten: Brasilien - Belgien - Bhutan. Perfekt! Andererseits hat der internationale Flughafen Bhutans nicht unbedingt den Ruf eines essenziellen Drehkreuzes im europäisch-südamerikanischen Flugverkehr, was dann wohl letztlich doch für die Wahl Belgiens spricht. Welch wichtige Rolle jedoch solche Alliterationen im Unterbewusstsein spielen, darf übrigens nicht unterschätzt werden. Ein befreundeter Journalist, seit Urzeiten in Brasilien tätig, erzählte neulich die wunderbare Geschichte von Ex-Präsident Ronald Reagans Brasilienbesuch. Hier angekommen, begrüßte er die Presse mit den Worten: Hallo Bolivien! Auf seinen Irrtum aufmerksam gemacht, versuchte er sich ehrenvoll aus der Affäre zu ziehen: Die Reise sei lang und beschwerlich gewesen, und da habe er Brasilien mit dem nächsten Ziel seiner Südamerikatour verwechselt. Morgen fliege er nämlich nach Bolivien weiter. Und so bestieg er am nächsten Tag die Air Force One und flog nach - Bogota!
Die drei Millionen Hektar des Projektes würden, so die Zeitung, der Größe Belgiens entsprechen. Während ich verwundert meinen Kopf schüttele, taucht der meines Mitbewohners in der Zimmertür auf. "Mir ist noch was zu Belgien eingefallen: Die haben die beste Schokolade überhaupt. Unübertroffen." Und im Weggehen fügt er noch hinzu: "Die habe ich allerdings damals in Deutschland gekauft, weil sie da billiger war." Ob die Belgier auch nur annähernd eine Ahnung davon haben, was hier in ihrem Namen vor sich geht? Text + Fotos: Thomas Milz |
|
[art_4] Argentinien: Durch den schönen Norden – Teil 2 [Teil 1]
Nach einem erneuten abendlichen Ausflug geht es mit dem Bus am Morgen nach San Salvador de Jujuy, wo wir nur eine Nacht bleiben werden, um uns ein weiteres Auto zu mieten. Im Bus ergibt sich ein nettes Gespräch mit einem argentinischen Clown. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: es ist ein Pantomime, der auch schon in Europa aufgetreten ist und sich nun mehr schlecht als recht durch das Leben kämpft, seinen Mut aber beileibe nicht verloren hat. Er spricht ein wenig Deutsch, weil er eine deutsche Freundin in Freiburg hatte und wir gehen gemeinsam in Jujuy auf ein Bier. Er erzählt uns, warum er tatsächlich hier ist. Er wollte eine Dame treffen, die er im Internet kennen gelernt hatte. In diesem Zusammenhang erklärt er uns, was mich als Medienwissenschaftler ein wenig überrascht, dass es gar nicht so einfach sei, im realen Leben Mädchen zu treffen, die sich nicht natürlich geben und beim abendlichen Ausgehen ehrlich seien. Das hat mich doch verblüfft, da das Internet, insbesondere Chaträume, ja mittlerweile als Rückzugsort für Menschen gilt, die sich in der sozialen Öffentlichkeit nicht so einfach bewegen wie andere. Aber wie dem auch sei, es ist ein angenehmes Gespräch und so verkürzen wir zusätzlich die Nacht in Jujuy, das als Stadt wahrlich nicht viel zu bieten hat.
Entlang der Quebrada fahren wir mit dem Mietauto in Richtung Purmamarca, wo wir auf dem Weg einige kleine Sehenswürdigkeiten passieren. Immer wieder kommen wir an Kakteenwäldern vorbei, die uns gedanklich doch eher nach Mexiko versetzen, aber diese Pflanze ist durchaus auch hier im Norden Argentiniens äußerst häufig anzutreffen und nicht zuletzt dient das Holz seit jeher dem Bau von Beichtstühlen, Truhen, Dachbalken und Türen. Das Städtchen Purmamarca lassen wir zunächst im wahrsten Sinne des Wortes links liegen und fahren weiter nach Tilcara, wo es die gleichnamige Ruinenstätte zu besichtigen gibt. Dennoch lassen wir uns zunächst von dem kleinen Andenmarkt einnehmen, da meine Gefährten allesamt noch Mitbringsel für die Daheimgebliebenen brauchen. Die Artesanías unterscheiden sich nur geringfügig von denen aus Bolivien und Peru, und das ist auch nicht verwunderlich, denn bis an die Grenze zu Bolivien sind es gerade mal 150 Kilometer Luftlinie. Die Ruinen sind nicht gar so einnehmend und nach einem kurzen Rundgang entschließen wir uns nach Maimará zu fahren, wo es zwei Dinge zu sehen gibt. Zum einen den Friedhof, der auf einem kleinen Hügel errichtet wurde und durch zahlreiche bunte Gräber bizarr und unübersichtlich anmutet. Zum anderen eine hinter dem kleinen Ort liegende Gesteinsformation, die sich La paleta del Pintor, die Malerpalette, nennt. Der Berg nimmt aufgrund von Erosion und verschiedener Mineralien unterschiedliche Farben an, die sich je nach Sonnenstand in der Intensität unterscheiden und phantastisch anzusehen sind. Wir lassen es uns nicht nehmen, hier den letzten Schluck Wein zu trinken und die letzten Früchte zu essen, ehe wir unser Nachtquartier in Purmamarca beziehen. Purmamarca ist ebenfalls ein kleiner Andenort, allerdings nicht mehr auf der Ruta 9, sondern auf der Ruta 52, die nach Chile führt. Malerisch erhebt sich im Hintergrund der Cerro de los Siete Colores, Der Berg mit den sieben Farben. Ähnlich wie bei der Malerpalette bestimmen Mineralien die unterschiedliche Farbgebung des Berges, der in Wahrheit mehr als sieben Farben beinhaltet. Wir kommen gerade noch rechtzeitig für ein abendliches Photo, dann heißt es die morgendliche Sonne ausnutzen und früh aus den Federn zu steigen. Den Abend verbringen wir bei einem letzten gemeinsamen Essen, denn zwei meiner Kollegen nehmen den Mietwagen mit zurück nach Jujuy, um dann weiter nach Iguazú zu reisen, um die berühmten Wasserfälle zu sehen. Ich hingegen möchte noch weiter nördlich zum Andenort Iruya mit seinen nur 120 Einwohnern inmitten der argentinischen Puna. Der siebenfarbige Berg funkelt im Morgenlicht noch schöner und ich genieße die frische Luft bei einem Mate und sehe den Einheimischen dabei zu, wie sie den Markt für die Touristenbusse aufbauen. Beim Frühstück treffe ich einen Mann, der mir wärmstens die Grandes Salinas, die großen Salzseen, ans Herz legt.
Da wir den Preis in Ordnung finden, packen wir kurz entschlossen das Nötigste ein und fahren zusammen mit einer Argentinierin und einer Amerikanerin zu den Salzwüsten. Schon der Weg dorthin ist aufregend. Eine Serpentine jagt die nächste und gibt immer wieder abwechselnd Blicke auf Bergspitzen und Täler frei. Als wir den 4.200 Meter Pass überqueren, sehen wir schon den Salzsee eingefasst von kleineren Bergketten schneeweiß schimmern. Wer hier keine Sonnenbrille dabei hat, kann beim besten Willen dieses Stück Natur nicht wirklich genießen. Zehn Männer arbeiten an einer Stelle und sind von oben bis unten eingepackt, das Gesicht ist ebenfalls verhüllt. Durch das reflektierende Licht haben sich wahrscheinlich schon viele verbrannt. Die Sicht ist atemberaubend. So weit das Auge reicht erstrahlt es weiß und durch den Wind entstehen Sandwaben. Ein bizarrer Anblick, den wir bei einem kleinen Rundgang erst richtig genießen. Es wird also nach wie vor Salz aus den vertrockneten Seen gewonnen und natürlich darf auch hier ein kleiner Stand nicht fehlen, wo Salzkristalle und Steinplatten mit alten Motiven und Inschriften verkauft werden. Noch vor Sonnenaufgang machen wir uns auf den Weg in Richtung Humahuaca, den Ort, von der die Quebrade ihren Namen bekommen hat, der allerdings wenig spektakulär ist. Wir nutzen ihn lediglich, um weiter nach Iruya zu fahren; in einem wahren Chickenbus, dass mir jetzt noch die Knie wehtun, wenn ich daran denke. Der Bus ist überfüllt, was einfach daran liegt, dass nach Iruya nur zweimal am Tag Busse fahren und er für eine Strecke vier Stunden braucht, auch wenn es lediglich 80 Kilometer sind. Die Strecke ist nicht die Beste und man sollte die Pinkelpausen nutzen, denn man wird ordentlich durchgeschüttelt.
Eine Aussicht über den ganzen Ort und eine eigene Terrasse für gemütliche Stunden, das ist ganz in unserem Sinne. Nach einem schnellen Essen machen wir uns wieder einmal auf den Weg, die nahe Umgebung zu erkunden. Für mehr als drei Stunden Wanderung ist heute keine Zeit mehr, aber das ist nicht so schlimm, einen kleinen Einblick in die Gegend hier bekommt man allemal. Einem Fluss folgend steigen wir bergauf und sehen schon jetzt, dass die Berge auch hier funkeln. Zwar nicht mehr so bunt wie in Purmamarca, aber zusammen mit dem intensiven Blau des Himmels, schimmern die Bergketten smaragdgrün, sonnengelb und goldbraun. Am Abend lassen wir uns von der „Dueña“ Mate und Brot mit Dulce de Leche, süßem Karamellaufstrich, verwöhnen und genießen die letzten Sonnenstrahlen, ehe es kühl wird und wir zum Essen gehen. Hier im Ort scheinen allerdings in der Nebensaison die Uhren anders zu ticken. Auch wenn ein Argentinier für gewöhnlich nicht vor 9 Uhr Abends ans Essen denkt, hier wird es schon um 8 Uhr schwierig etwas zu finden. Aber hinter einer Türe verbirgt sich dennoch ein Restaurant, das nur leider keinen Wein führt.
Früh geht es diesmal in Flussrichtung abwärts der Quebrada entlang, ehe wir scharf nach links abbiegen, um an einen Nachbarort, zwei Stunden Fußmarsch entfernt, zu gelangen. Immer wieder müssen wir Flussläufe passieren, was bei der unbarmherzigen Sonne aber stets eine willkommene Gelegenheit ist, sich abzukühlen. So kalt die Nächte sind, am Tag wird es immer recht warm. Die Puna ist karg und von Vegetation ist nicht allzu viel zu sehen. Lediglich die immer wieder sehenswerten Gesteinsformationen lassen unsere Unternehmung zu einem Erfolg werden. Dennoch müssen wir am Nachmittag nach Humahuaca zurückkehren, weil von dort aus der Bus in Richtung Salta geht und wir noch einmal das Nachtleben dort genießen wollen, ehe es über Rosario, die Geburtsstadt Ernesto Guevaras, nach Buenos Aires zurückgehen soll. Text + Fotos: Andreas Dauerer |
|||||||||||||||||||||||||||
|
[kol_1] Amor: Kleine Mystik für deutsche Auswanderer
In diesen Tagen jährt sich nun zum 10. Mal der Beginn meiner privaten Odyssee (Berlin Neapel · Barcelona) und da erlaube ich mir einfach mal, mich in den Stand eines Auswandererveteranen zu erheben. Leider gibt es dafür keine etablierte Zeremonie, so dass ich hiermit erkläre, dass die Veröffentlichung dieser Zeilen im caiman eine dahingehende rechtsgültige Wirkung hat. Bekanntermaßen machen Veteranen nichts anderes als den ganzen Tag das Jungvolk mit der (wiederholten) Erzählung längst vergangener Schlachten zu langweilen und dabei an den richtigen Stellen den Zeigefinger zu erheben. (Der vorstehende Satz gilt nicht für die USA, wo Veteranen sich vor allem damit beschäftigen, vor Gericht um längst vergangenen Schlachten zu streiten. Ich glaube nicht, dass man einem amerikanischen Tribunal ungestraft den erhobenen Zeigefinger entgegenstrecken darf.)
Nachstehend habe ich als frisch gebackener Veteran einige Punkte zusammengestellt, die der Neuauswanderer besser hilfreich und interessant finden sollte, denn ich gedenke diese Punkte bis zum Erbrechen zu wiederholen. Ist ja nur für ein Jahr… Eine der beliebtesten Einstiegslügen für Auswanderer. Stimmt einfach nicht, ist auf jeden Fall gelogen. Wer das Auswandern im Blut hat, der bleibt niemals nur ein Jahr. Und der Rest, das sind Touristen, die einen längeren Urlaub machen. Herrlich hier! Kleine Notlüge, die gegenüber Besuchern aus der Heimat immer angebracht ist. Schließlich müssen die ja nicht merken, dass man gerade vor Heimweh umkommt! Die Leute hier sind ja sooo offen… Achtung Neuauswanderer: bloß nicht auf diese oder ähnliche Behauptungen reinfallen. Der Satz mag überall dort stimmen, wo ich persönlich noch nicht gewohnt habe, aber… Ihr versteht schon. Ach, guck doch, diese Deutschen da! Wie sagt doch meine Mutter: Familie sind auch Menschen. Dasselbe gilt für unsere Landsleute. Yo hablar sempre solamente espanol. Nichts ist peinlicher als das zwanghafte Aufzeigen, wie unglaublich integriert man ist. Eine kleine Anekdote mag das verdeutlichen: Geburtstag mit 10 Gästen. Davon einer (in Zahlen 1), der kein Deutsch sprach. Preisrätsel: welches war die Konversationssprache? Man möge das bitte nicht mit einer übergroßen Höflichkeit gegenüber der Gastkultur verwechseln: es geht einzig und allein darum zu zeigen, wie unglaublich integriert man ist und wie total natürlich man sich in der fremden Sprache bewegt. Das können Spanier einfach nicht. Ulkigerweise hört man Sätze wie diesen häufig in der Nähe von Aussagen wie der des vorherigen Abschnitts. Dieser Cocktail aus Integrationssucht und gleichzeitiger Verachtung des Gastlandes ist hochmerkwürdig. Vor allem wenn man die Liste der am meisten genannten Gründe für die Minderwertigkeit des Spaniers im Allgemeinen betrachtet: a) Heizungsrohre werden nicht exakt parallel verlegt (Abweichung von bis zu 1,235 Grad(!) sollen beobachtet worden sein.) b) Telefónica hat – ganz im Gegenteil zur Telekom – einen miserablen Service c) Autobusse haben keine festen Abfahrtszeiten, sondern nur Frequenzen (alle 5-7 Minuten) d) der Schuhladen macht ganze 10 Minuten später auf als angekündigt Die rein deutschen Siedlungen an der Küste, auf Mallorca oder rund um die deutsche Schule in Barcelona sind keine besonders gute Werbung für uns. Die haben mich glatt für einen Spanier gehalten! Vergiss es einfach. Man denke nur an die Türken in Deutschland, die nach wie vor als solche bezeichnet werden, obwohl sie bereits in dritter Generation in Deutschland leben und arbeiten. (Der vorsichtige Versuch, ein –stämmig an das Adjektiv türkisch anzuhängen, wird von mir wegen dümmlich einfach ignoriert.) Keiner fragt mich mehr, woher ich komme! Das liegt einfach daran, dass es schon alle wissen. Man sollte sich besser darüber im Klaren sein, dass man immer ein eigenartiges Zwitterwesen bleiben wird. Und jetzt kommt der gute Part: das muss nicht schlecht sein. Mimikry ist nicht gleich Integration. In Deutschland machen wir das so und so. Vorsicht! Als Auswanderer sollte man nie vergessen, dass der Expertenstatus bezüglich des eigenen (?) Landes auf einer langsam dahin schmelzenden Basis aufsetzt. Gesellschaften entwickeln sich und das sogar in unserer Abwesenheit! Wenn man erst die Sprache kann, ist alles einfach. Jeder echte Emigrant weiß, dass der Aufenthalt in einem Gastland einer Fahrt auf der Psychoachterbahn gleicht: hoch und runter, hoch und runter rast das Gemütswägelchen. Und uns Emigranten ist die meiste Zeit dabei zum Schreien zumute. Ich bin seit langem der Meinung, dass eine Art Exildepression existiert, die an unser aller Nerven rüttelt. Das klingt erstmal wenig appetitlich, aber wenn man bedenkt, dass in der anderen Waagschale die totale Horizonterweiterung liegt, ist das vielleicht nicht zu teuer bezahlt. (Fairerweise sollte man hier auch noch das Wetter erwähnen: immer wenn ich meine Berliner Freunde besuche und wir dann freudlos Johanniskrautpillen kauend vor der Lichttherapielampe sitzen…) Wenn ich will, kann ich ja jederzeit zurück. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha… Der war echt gut! Das soll fürs erste reichen. Sicher werde ich im Verlauf der nächsten Zeit noch weitere geistreiche Aphorismen von mir geben, oder einfach die oben stehenden wiederholen. Zur Feier meines neuen Status möchte ich aber den Artikel nicht beenden, ohne einen Toast ausgesprochen zu haben: Danke, dass ich freiwillig auswandern durfte und nicht musste. Danke, dass ich aus dem reichen Europa komme. Danke, dass man mich überall gut aufgenommen hat. Danke, dass meine Freunde mich in all den Jahren nicht verlassen haben. Prost Neujahrzehnt! Text + Fotos: Nil Thraby [druckversion gesamte ausgabe] / [druckversion artikel] / [archiv: amor] |
|||||||||||||||
|
[kol_3] Helden Brasiliens: Senhor Claude revisited - Zurück auf der Ilha Grande
Schon von weitem sehe ich es: Der Hut ist ein anderer! In seinen 44 Jahren hier in Brasilien war der grau-verwuselte Hut Senhor Claudes stetiger Begleiter, doch jetzt, im 45., wurde er durch eine blaue Mütze ersetzt. Während Pompom, sein Hund, genüsslich im Sand vor der Pousada Mara e Claude liegt, steht sein Herrchen am Eingangstor und raucht. "Pompom ist richtig berühmt geworden, seitdem Du sein Foto ins Internet gestellt hast. Manchmal kommen wildfremde Leute vorbeispaziert und rufen: "Hallo Pompom, alter Junge, wie geht`s?" Und wenn ich frage, woher sie ihn kennen, heißt es stets: hab ihn doch im Internet gesehen." Die kleine Pousada Mara e Claude mit ihren sechs geschmackvoll eingerichteten Zimmern ist ausgebucht.
In dem wohlwollenden Artikel findet sich eine Besprechung der Pousada. "Invés de ficar bobo olhando para o mar, temos a chance de conheçer muita gente interessante” wird Claude zitiert - "Anstatt durch das ewige auf das Meer Starren zu verblöden, haben wir die Chance, viele interessante Menschen kennen zu lernen." Er lächelt verschmitzt. "Die waren sehr nett, die Portugiesen. Aber Seefahrer waren sie nicht wirklich. Am ersten Tag haben sie ihre ganze Ausrüstung, Kameras und und und in ein Boot gepackt und wollten losfahren. Während sie noch mit dem Anlassen des Motors beschäftigt waren, sind sie auf die kleine dem Strand vorgelagerte Insel gebrettert und untergegangen. Die Frau kam pitschnass zurück und rief nur: "naufragamos!" - "Wir haben geschiffbrucht!". Das ganze Material haben sie verloren. Und so was will ne Seefahrernation sein?"
Von März bis zu den Schulferien im Juli ist es dagegen ruhig auf der Insel, genau wie zwischen August und November. Es hat sich herumgesprochen, dass die autofreie Insel über einige der schönsten Strände Brasiliens verfügt, versehen mit dem Postkartenmotiv blau-grünem Wassers, dichter dunkelgrüner Vegetation und erfrischend kühler Wasserfälle. Zudem kann man abends in den zahlreichen Restaurants des kleinen Hauptörtchens Abraão ausgiebig schlemmen und einen erfrischenden Drink genießen. So wie wir am Strand vor der Pousada. Nach der obligatorischen Garaffe Maracuja-Caipirinha, die Claude mit seinen Gästen zu Ehren jedes gelungenen und missratenen Sonnenunterganges zelebriert, zieht die Karawane in das benachbarte Fischrestaurant weiter. "Wenn das so weitergeht, werde ich auf meine alten Tage noch zum Alkoholiker", klagt der 70-jährige leise.
Und auf Portugiesisch brummelt er in sein Bier: "Ich habe schön und genug gesprochen, jetzt reicht es. Euch wird das Essen schon schmecken." Und später gesteht der in Frankreich geborene ehemalige Pastetenfabrikant selbstkritisch: "Alle Welt will einfach nur ein gutes Essen genießen. Egal wie der Fisch heißt oder ob das Gericht aus Rio oder Salvador stammt. Außer den Franzosen, die unbedingt alles Ess- und Trinkbare zu einer Kunst erheben müssen. Sie nerven die ganze Welt ständig mit neuen Wein- und Käsesorten. Unerträglich." Er steckt sich gemütlich eine Zigarette an und zieht voller Genuss daran. "Was ist eigentlich mit dem alten Hut geschehen?" Senhor Claude schaut sich verstohlen um.
Er zieht erneut an seiner Zigarette, nachdenklich. "Seit Jahren trage ich nichts mehr anderes als meine Strandshort und meinen Hut. Zu Nikolaus wollte ich ein Paar Schuhe vor die Türe stellen, doch dann ist mir aufgefallen, dass ich gar keine mehr habe. So ist das Leben." Text + Fotos: Thomas Milz
Die Ilha Grande liegt vor der Küste des Bundesstaates Rio de Janeiro. Boote fahren ab Mangaratiba (2 Stunden südlich von Rio) täglich um 8 Uhr, freitags zusätzlich um 22 Uhr. Rückfahrt von Abraão täglich um 17.30 Uhr. Von Angra dos Reis (3 Stunden von Rio und 7 Stunden von São Paulo) Montags bis Freitags um 15.30 Uhr, Samstags, Sonntags und an Feiertagen um 13.30 Uhr. Rückfahrt von Abraão täglich um 10 Uhr.
Mehr Infos unter www.ilhagrande.org. [druckversion gesamte ausgabe] / [druckversion artikel] / [archiv: helden brasiliens] |
|||||||||||||||||||||||||
|
[kol_4] Macht Laune: Al baño - Toilettenschmuck (Serie Kussbeschuss)
Zitate prominenter Zeitzeugen aufgearbeitet als Toilettenkarten zum Selbstdruck. 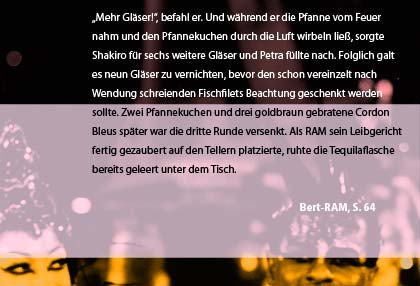 Download als pdf zum Selbstdruck  Download als pdf zum Selbstdruck 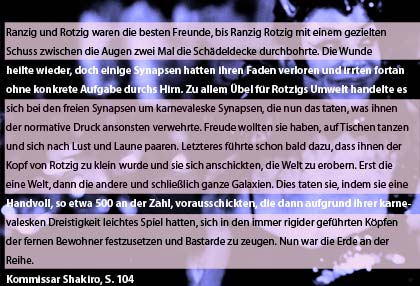 Download als pdf zum Selbstdruck  Download als pdf zum Selbstdruck  Download als pdf zum Selbstdruck Mehr zu: kussbeschuss - Kommisar Shakiro und die Rückkkehr des Aztekengottes Quetzalcoatl [druckversion gesamte ausgabe] / [druckversion artikel] / [archiv: spanien] |